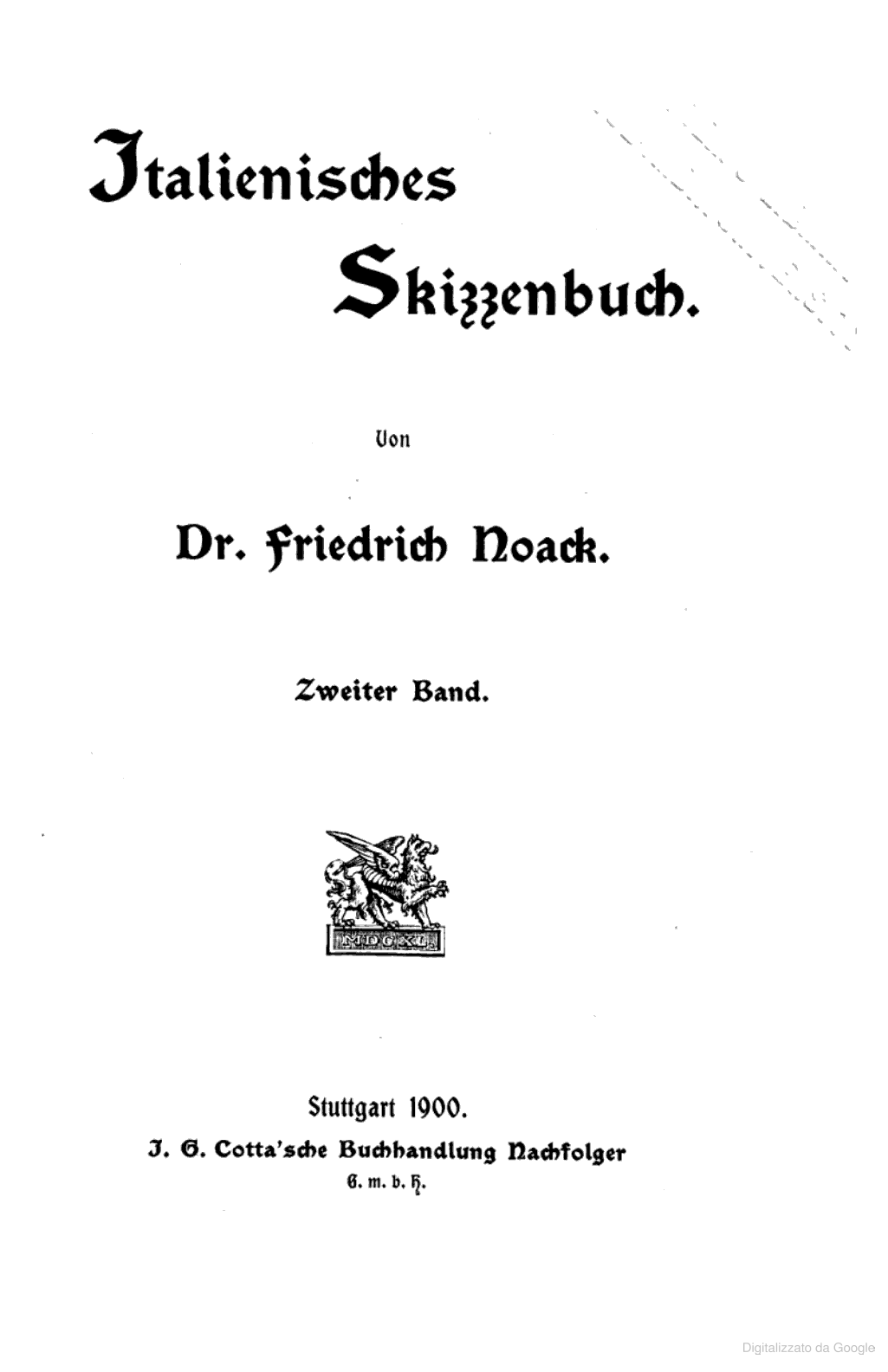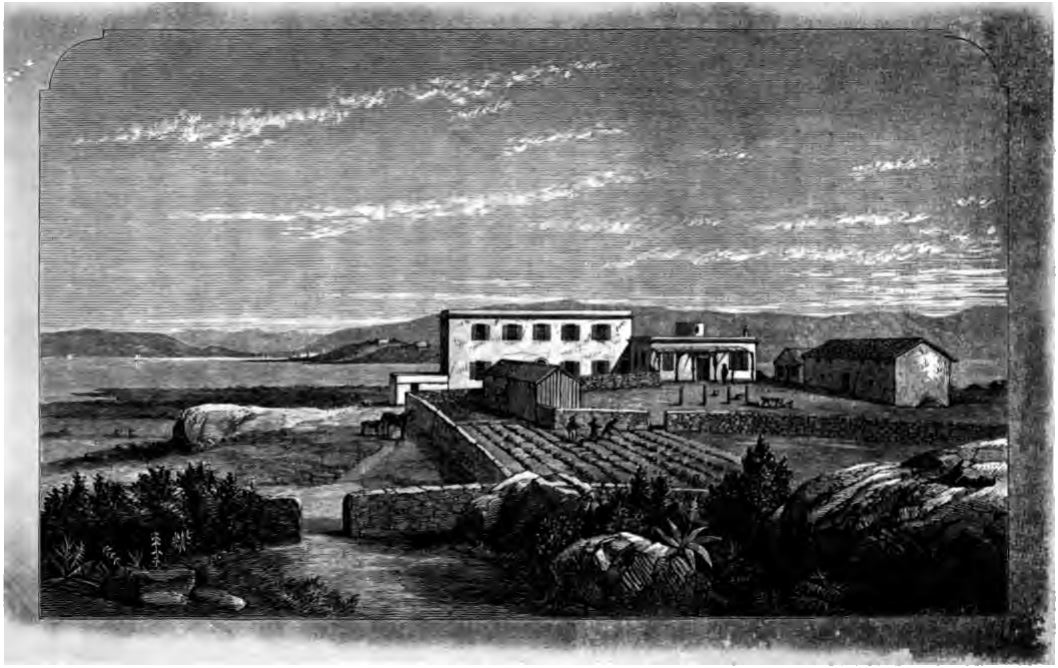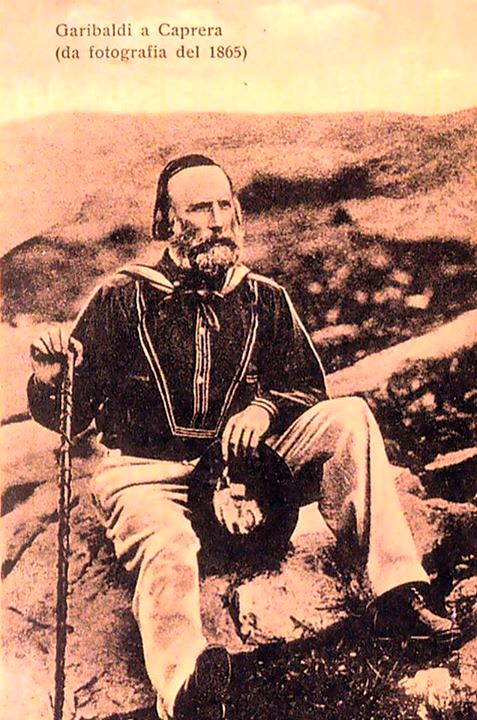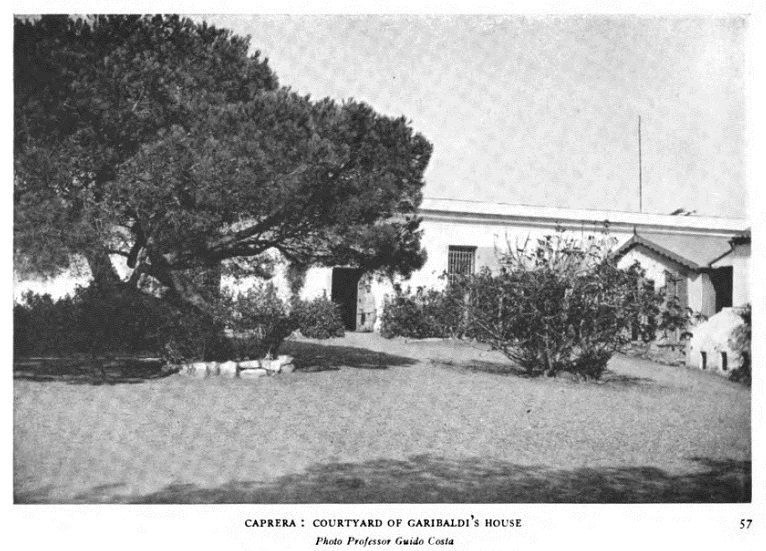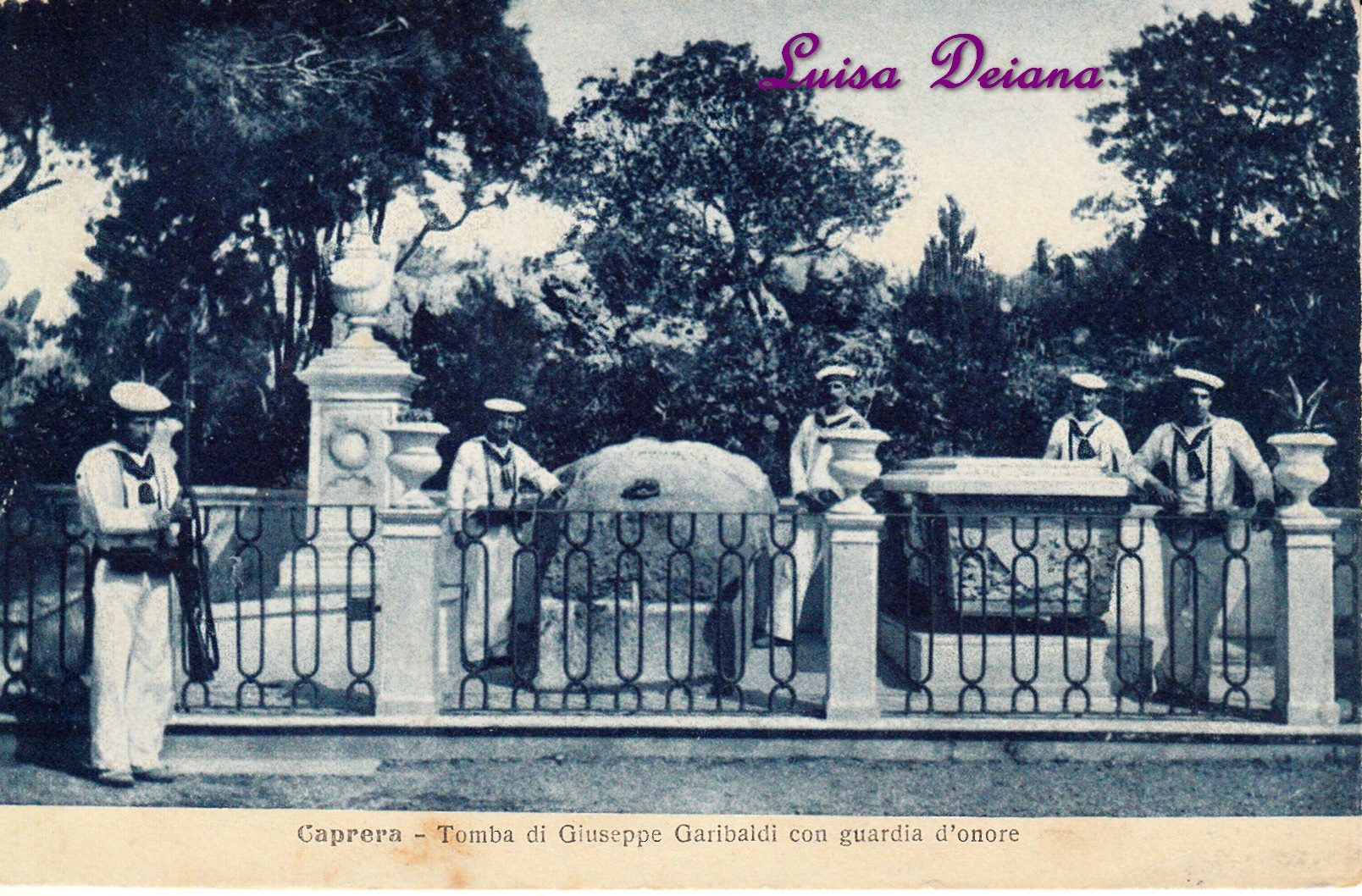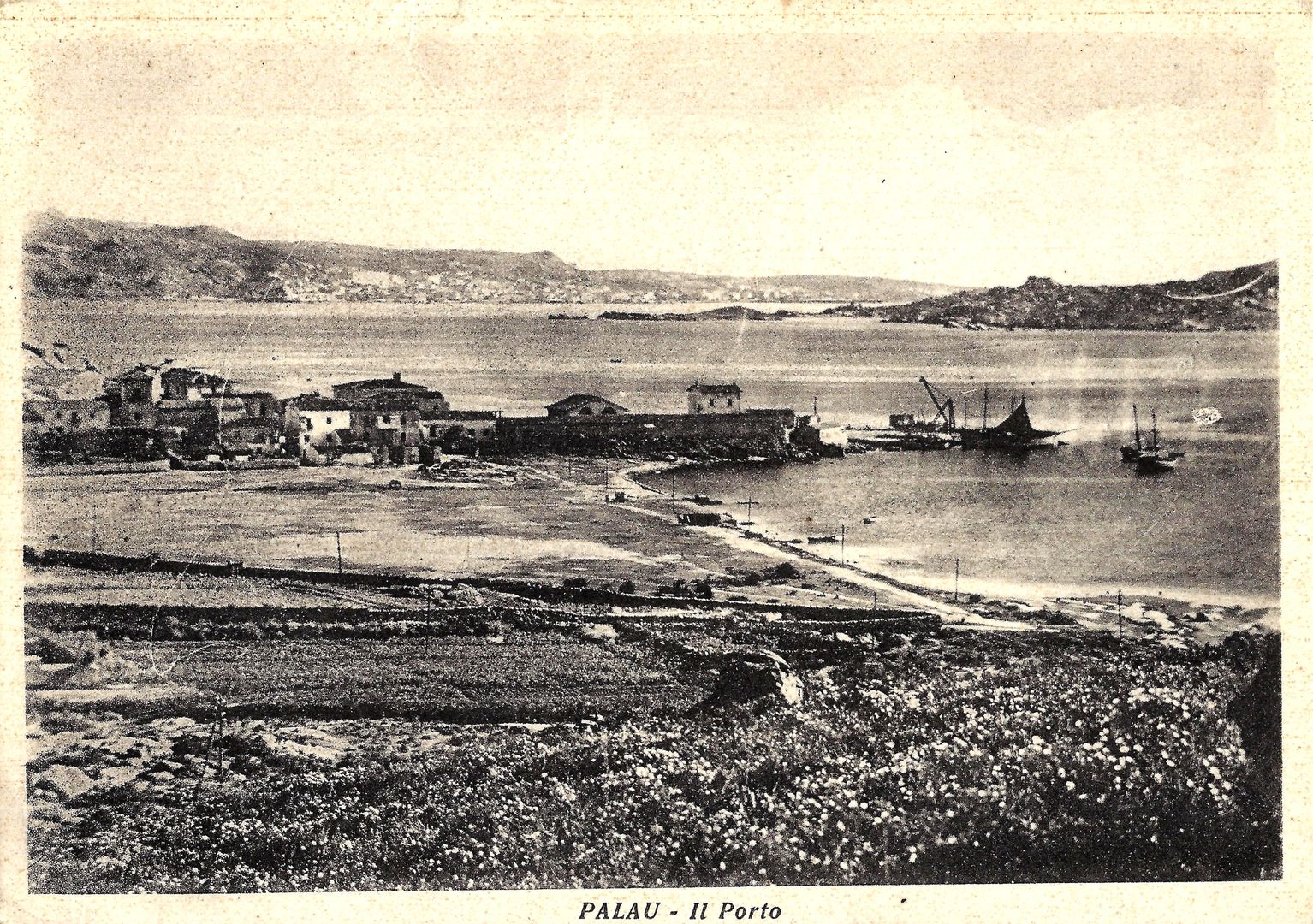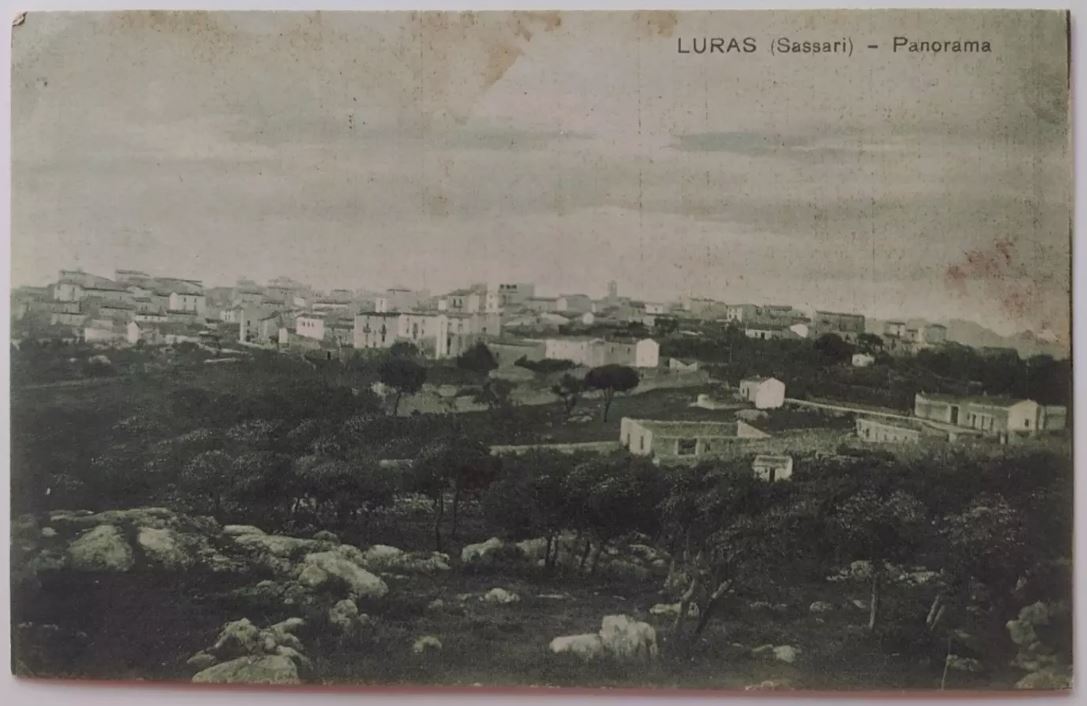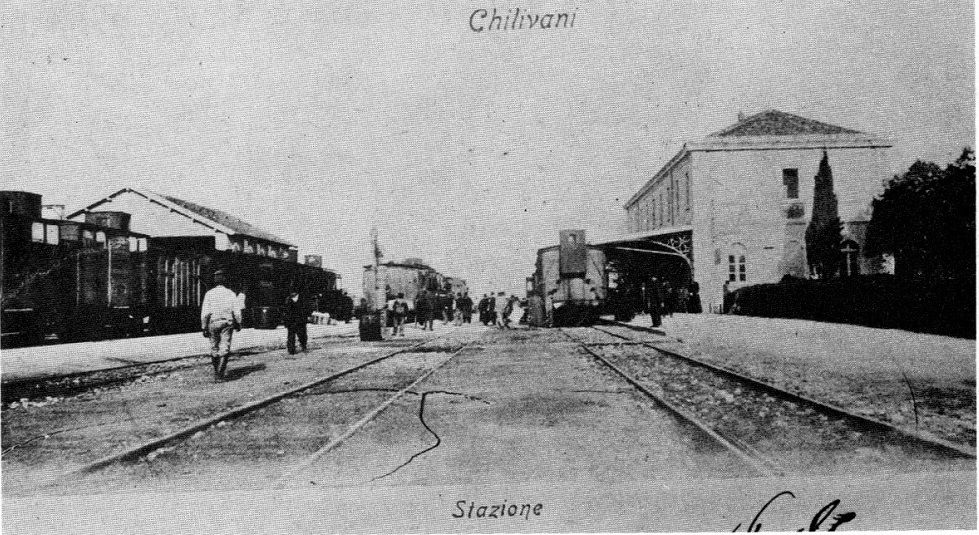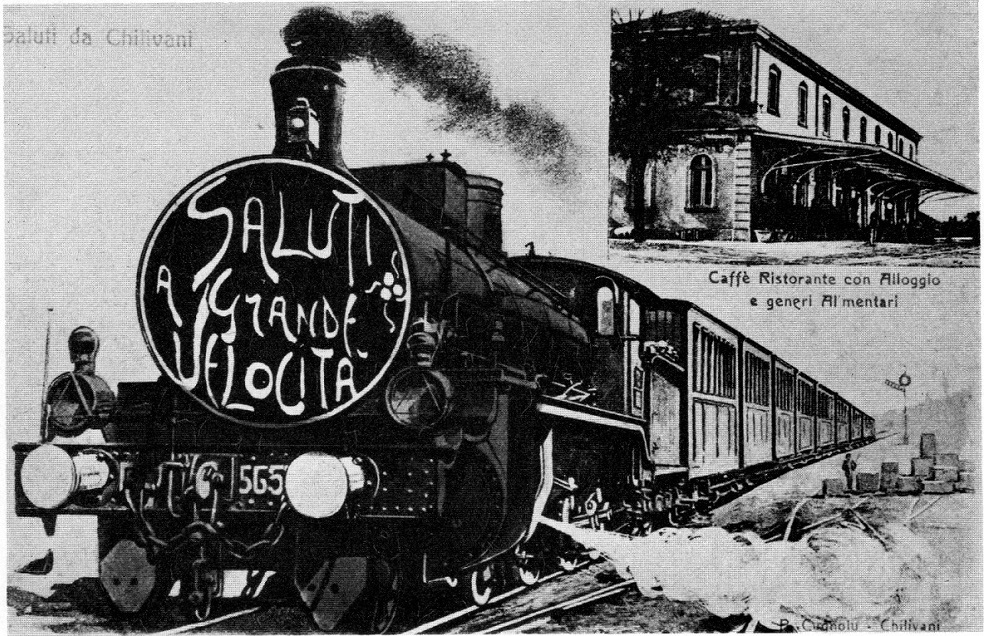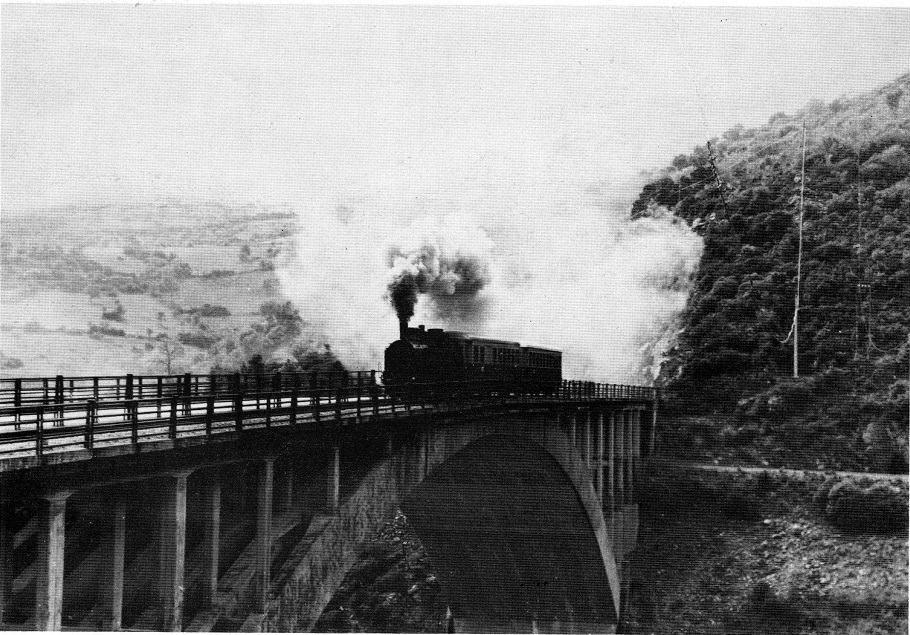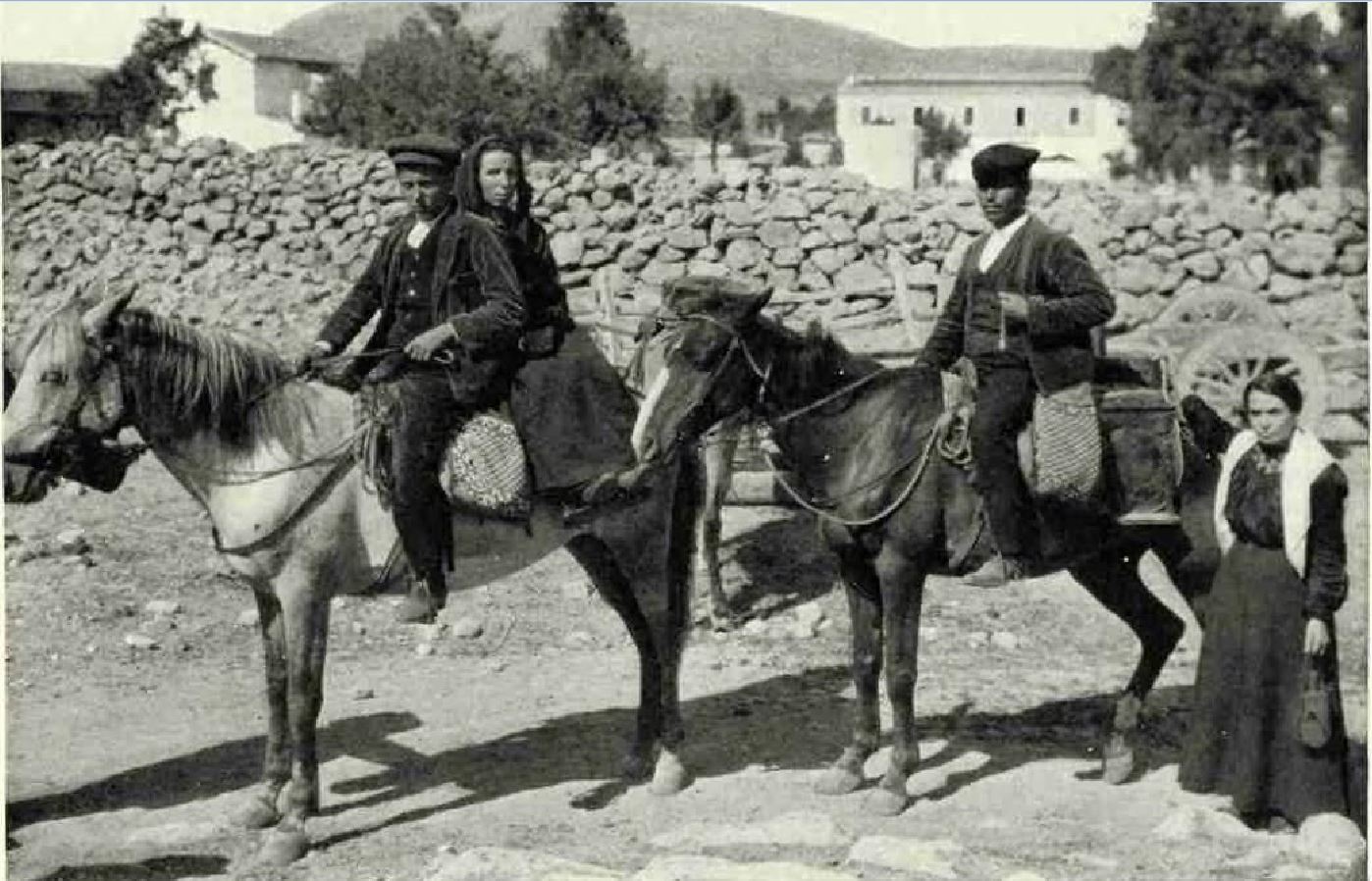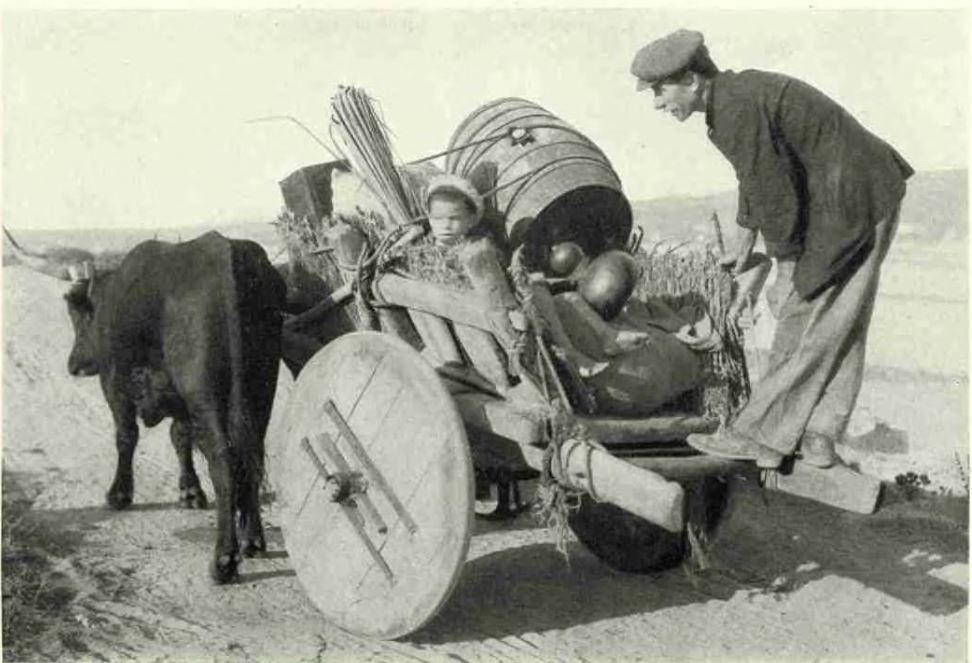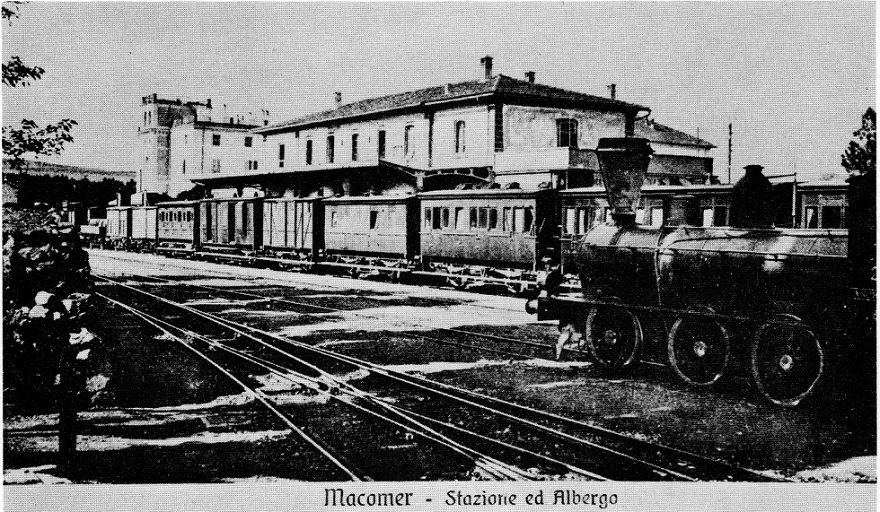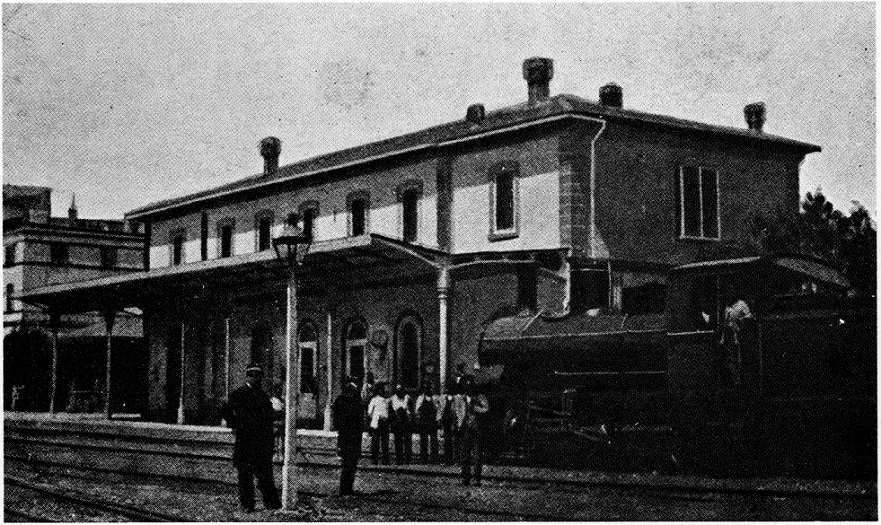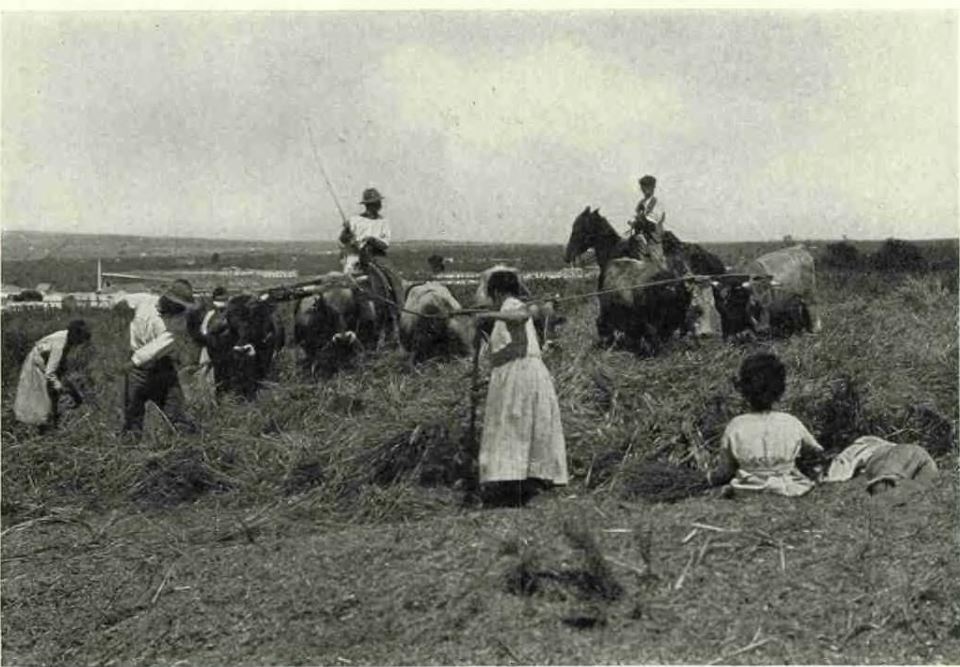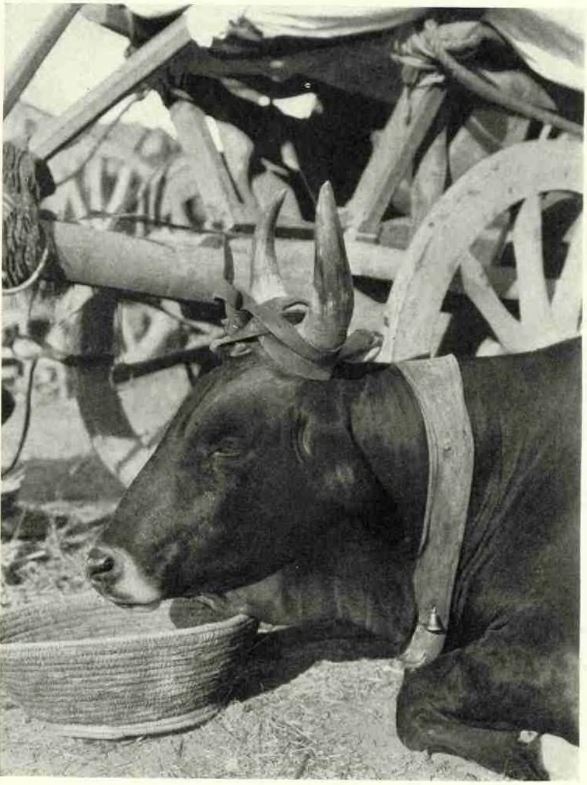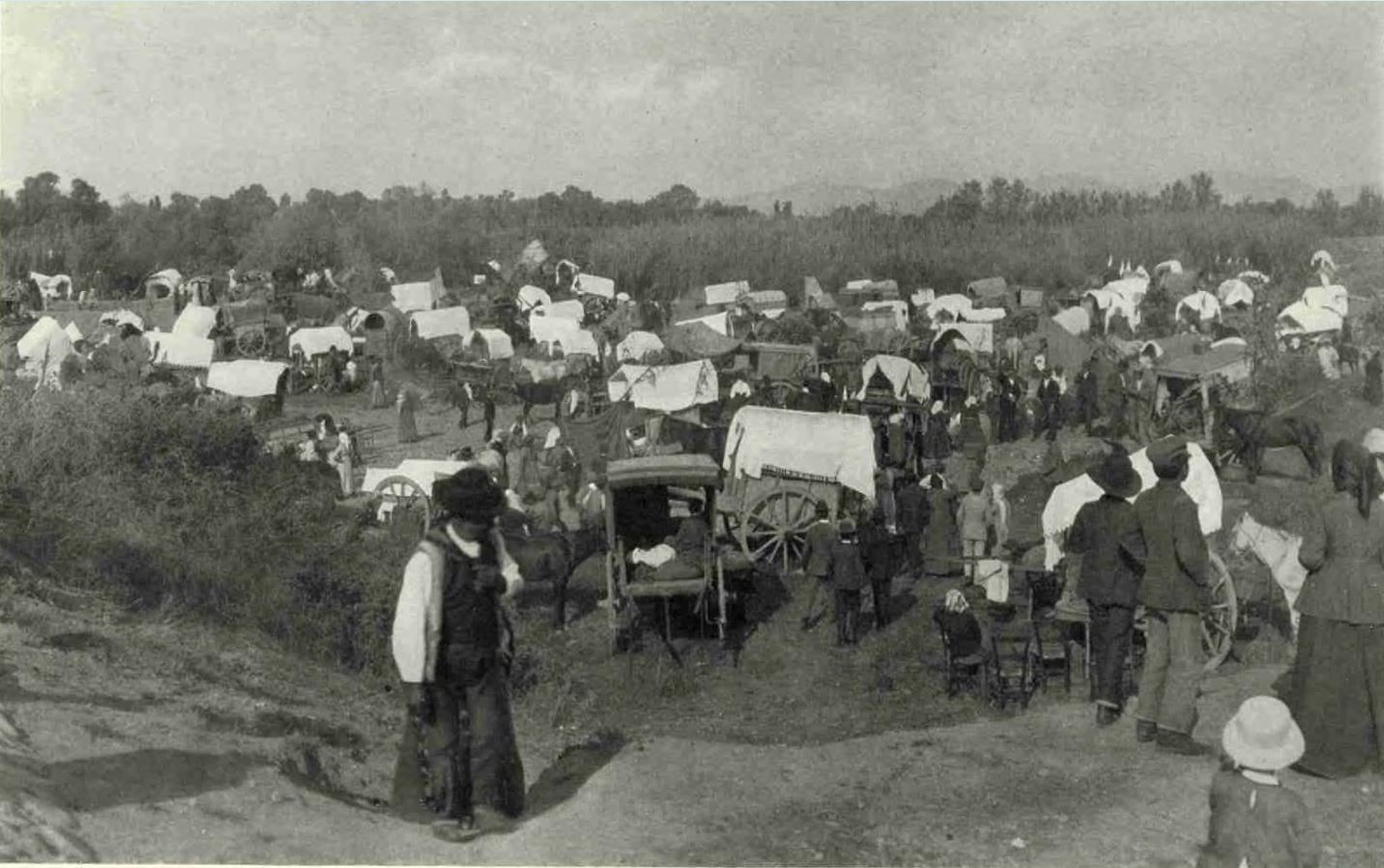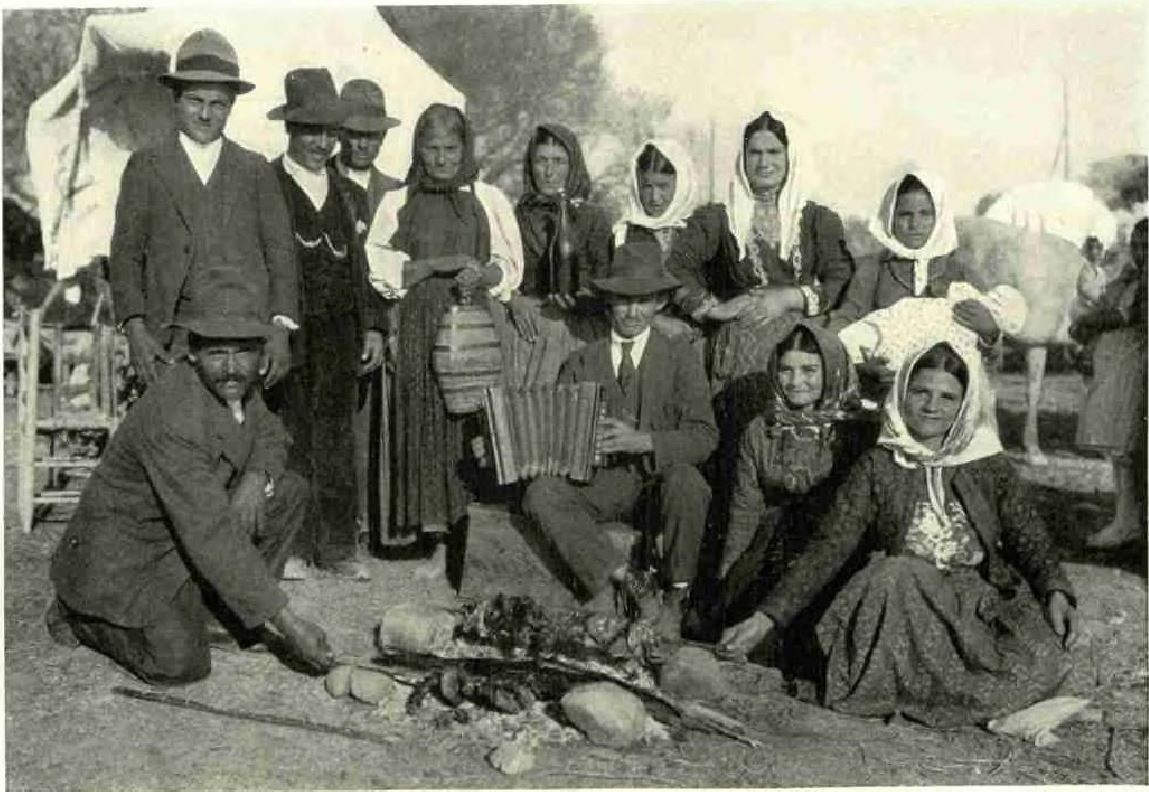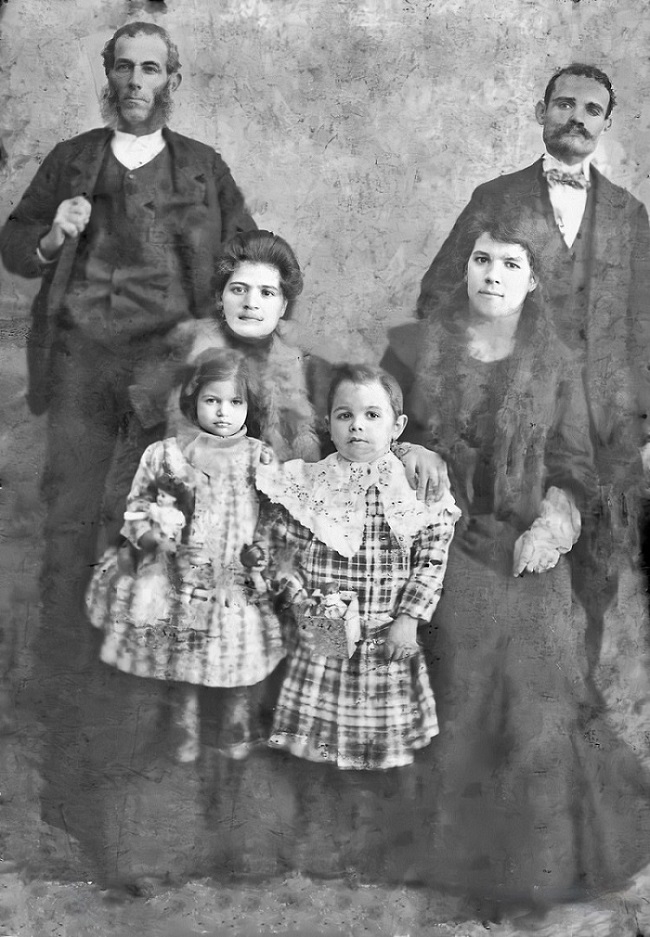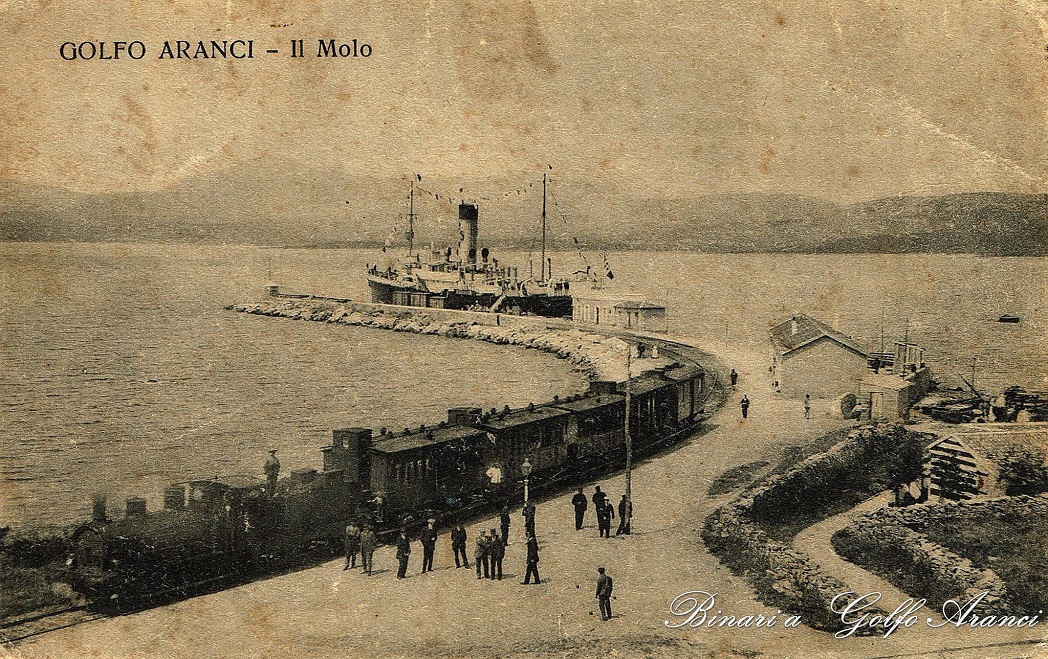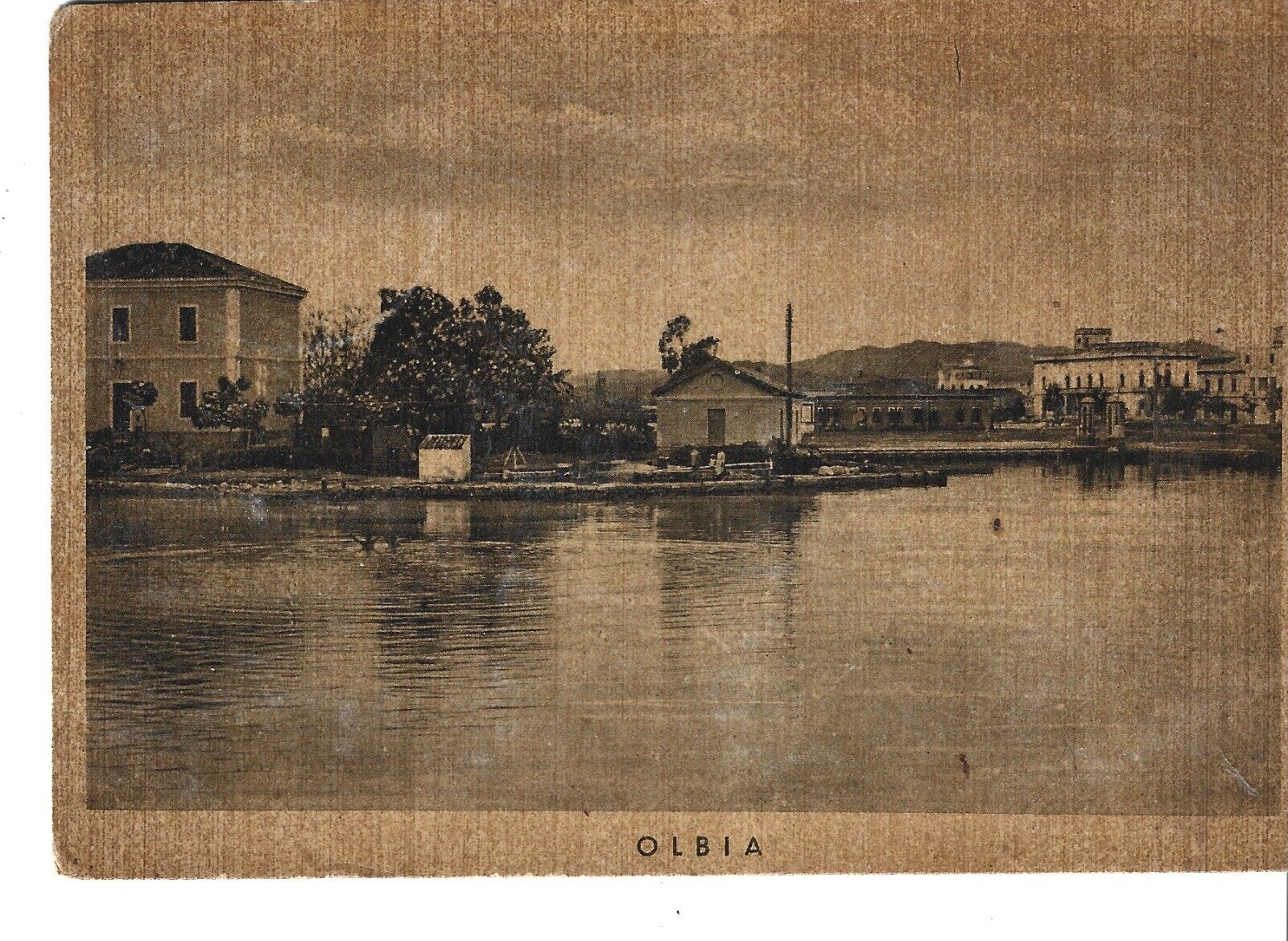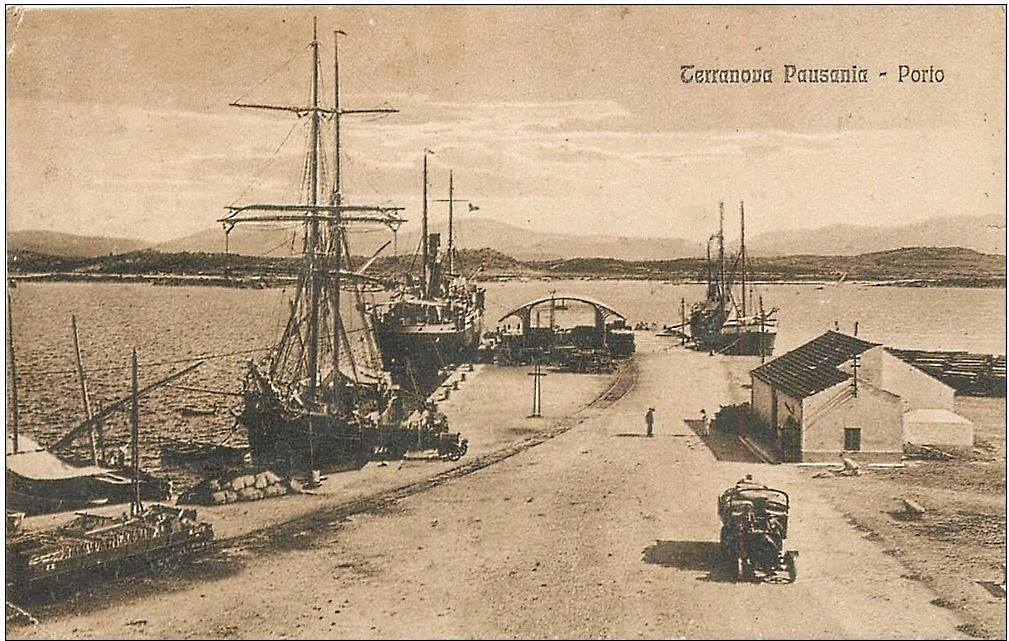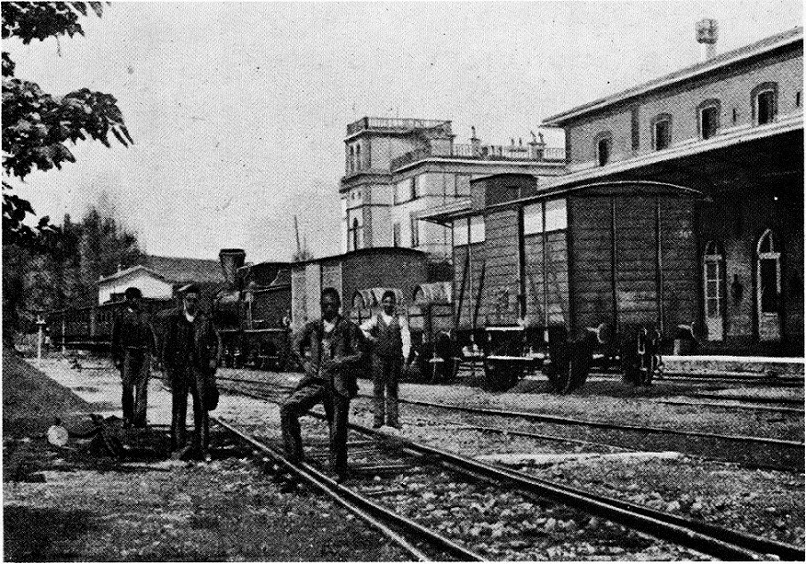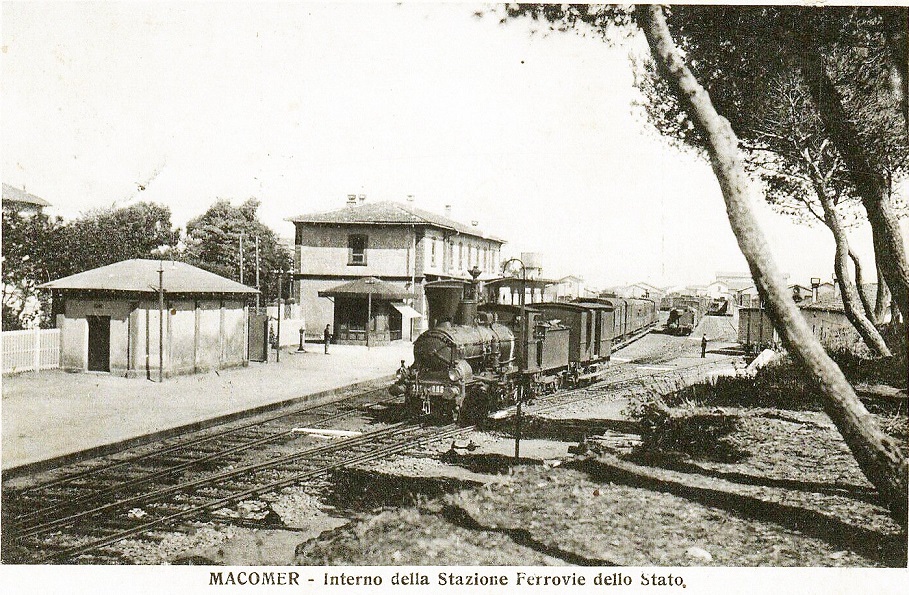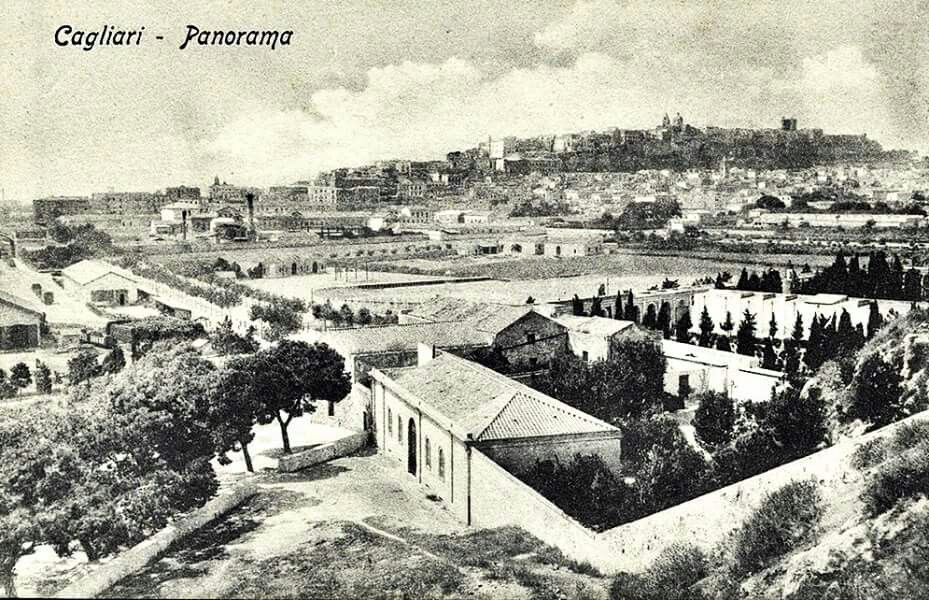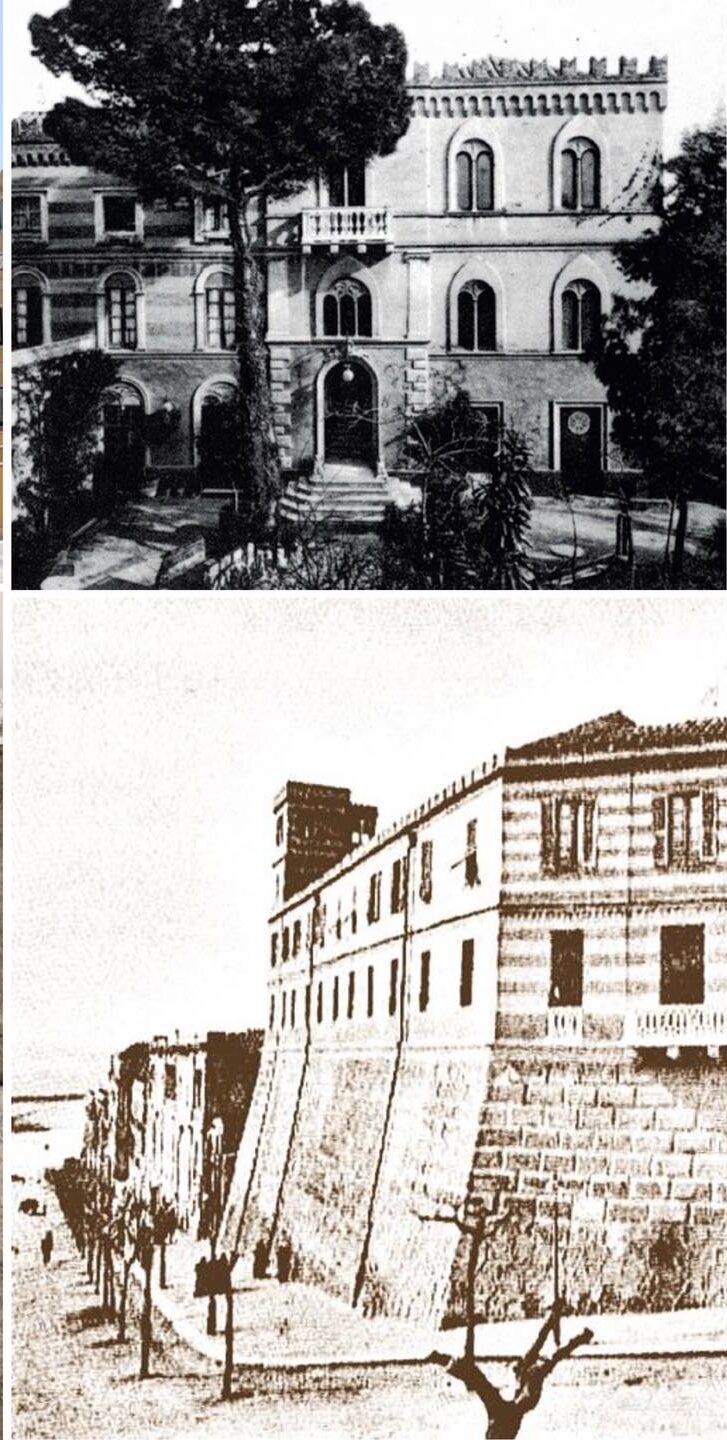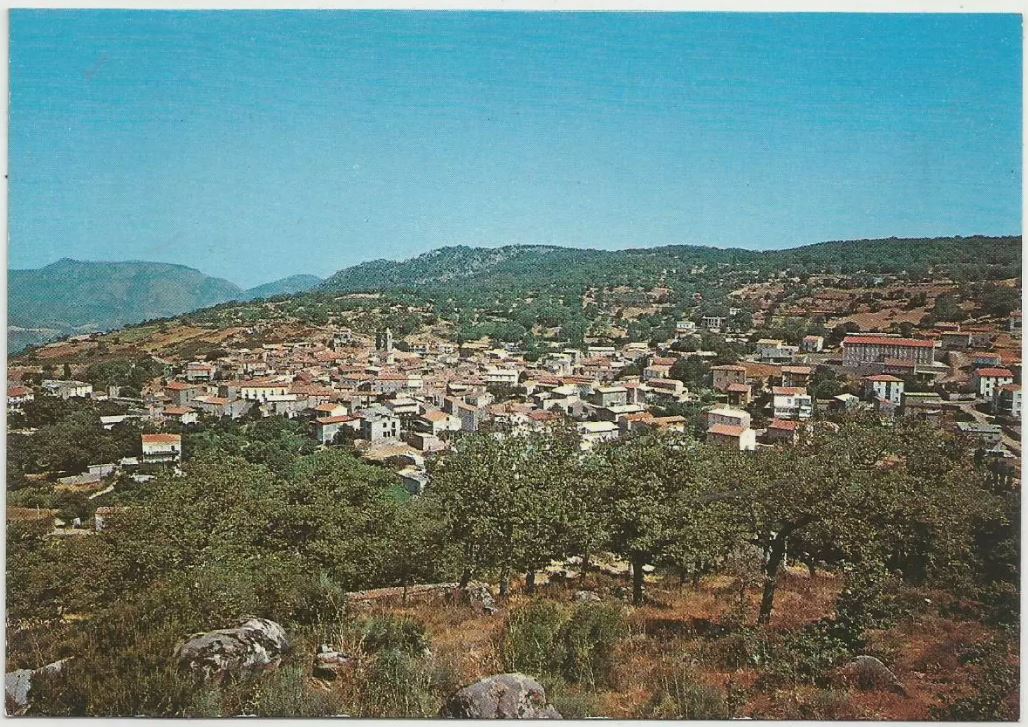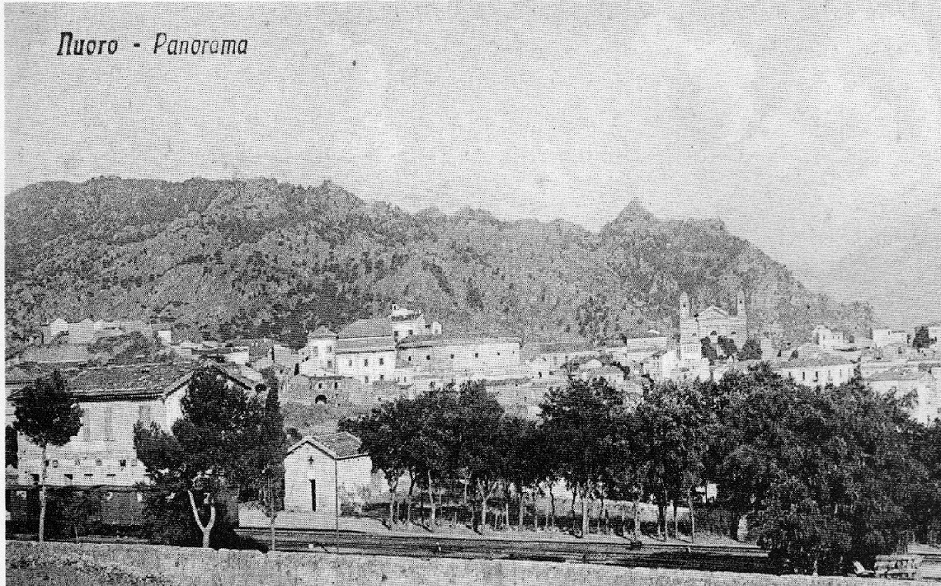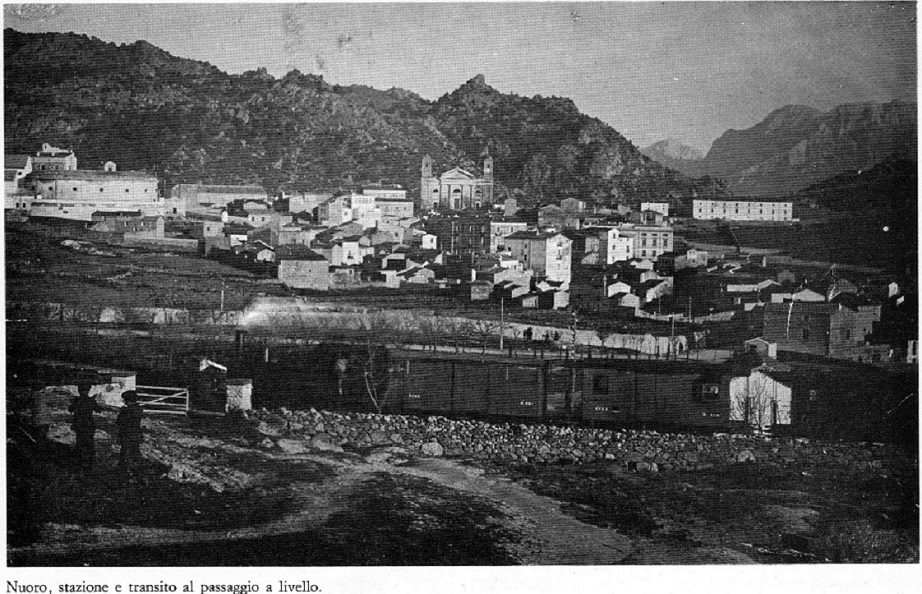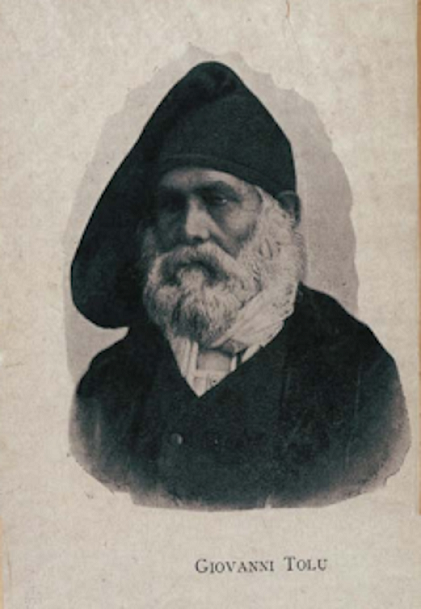REISEN DURCH SARDINIEN
von Friedrich Noack
Entnommen aus
ITALIENISCHES SKIZZENBUCH →
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger, 1900 →
zu FRIEDRICH NOAK siehe
WARNUNG. Der Haupttitel und die Überschriften der Absätze wurden speziell für diese Ausgabe eingefügt. Die wenigen im Original vorhandenen Titel sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
Auch die Illustrationen (in einigen Fällen mit Bildunterschriften) sind nicht im Originaltext enthalten. Die Fotos der Zeltlager beim Fest der Heiligen Greca in Decimomannu, nahe Cagliari, dienen als beispielhafte Darstellung des von Noack erwähnten Zeltlagers beim Fest in Oristano (und allgemein im Campidano).
Die Geschichte des berühmten Banditen Giovanni Tolu, die nach der Veröffentlichung von Enrico Costas Buch im Jahr 1897 internationale Aufmerksamkeit erlangte, wird am Ende als Anhang präsentiert – und nicht, wie im Original, zwischen der ersten Reise (April 1892) und der zweiten (Juni 1898) –, um der Erzählung eine bessere Struktur und Kohärenz zu verleihen.
INHALTSVERZEICHNIS
(Auf die Titel klicken)
ERSTE REISE, JUNI 1892
∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼
Auf dem Weg nach Cagliari – Abreise von Monti
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
ZWEITE REISE, APRIL 1898
* Palmsonntag in Quarto S. Elena
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
DRITTE REISE, APRIL 1898
* Ein Ritt durch die Bergwildnis der Barbagia
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Anhang – DER BERÜHMTE BANDIT GIOVANNI TOLU
* EIN SARDISCHES BANDITENLEBEN
ERSTE REISE, Juni 1892
* PFINGSTTAGE IN SARDINIEN (1892)
CAPRERA
* Maddalena, 2 juni 1892
Alljährlich wallfahrten die Getreuen Garibaldis, die seit Ende der vierziger Jahre im roten Hemde unter seiner Führung gekämpft und geblutet haben, die Reduci delle patrie battaglie von Palestrina, Rom, Calatafimi, Milazzo, Reggio, Monterotondo und so vielen anderen Schlachtfeldern, nach der kleinen Felseninsel Caprera zwischen Korsika und Sardinien, wo der Held zweier Welten manche Jahre der Ruhe pflegte, und wo er nach einem ungewöhnlich thaten reichen Leben zur lekten Ruhe eingegangen ist. Es sind heute zehn Jahre her, daß Giuseppe Garibaldi auf Caprera die Augen geschlossen hat; aber der Glanzpunkt seines Daseins liegt viel weiter zurück. Im Jahre 1860 stand er auf der Höhe seines Ruhmes, als er mit tausend Freiwilligen Sicilien von der Bourbonenherrschaft befreit und als Diktator der Revolution den Krieg bis vor die Thore Neapels getragen hatte, als er dann mit König Viktor Emanuel in dem befreiten Neapel einzog. Dann kam noch ein Aufflammen seiner Größe, als er 1867 Monterotondo erstürmte und auf Rom losgehen wollte, um dem jungen Königreich Italien seine Hauptstadt zu gewinnen. Aber damals zeigte er auch mit beklagenswerter Deutlichkeit die schwachen Seiten seines Wesens, den Mangel an staatsmännischen Begriffen und politischer Einsicht. Das Geschick hat eigentümlich gespielt, indem es gerade in Frankreich wenige Jahre später den Stern Garibaldis völlig erbleichen ließ, in demselben Frankreich, gegen dessen Heere er 1849 ruhmvoll die römische Republik verteidigt hatte, und dessen Chassepotgewehre 1867 bei Mentana gegen Garibaldis Scharen jene bekannten „Wunder“ verrichtet hatten. Man muß auch der Fehler und der lekten Mißerfolge Garibaldis nicht vergessen, wenn man nach der richtigen Schäßung seines Andenkens bei den Italienern sucht. Der große Garibaldi war schon fast zwanzig Jahre dahingeschieden, ehe der Tod seinen Körper vollends zerstörte; aber das italienische Volk hat auch in diesen zwei Jahrzehnten nicht den Dank vergessen, den eine edle Nation ihren Besten schuldet; die Italiener haben mit ihrer unerschütterlichen Verehrung für den Führer ihrer nationalen Erhebung mit einer Verehrung, die nicht abgeschwächt wurde weder durch äußere Mißerfolge, noch durch Thorheiten des Alters, ein Beispiel nationaler Dankbarkeit gegeben, aus welchem manche andere Völker noch lernen könnten. In der Geschichte lebt der Einsiedler von Caprera als ein ungewöhnlicher Mensch mit großen Tugenden und großen Fehlern fort, in dem Herzen des italienischen Volkes dagegen steht sein Bild fleckenlos wie das eines Halbgottes da, umgeben von einer dankbaren Bewunderung, die gerade in ihrer Blindheit etwas Rührendes hat. Der Name Garibaldi ist und bleibt den Italienern ein Symbol des nationalen Gedankens; damit ist alles erklärt.
Auch die Eigenart des Erinnerungsfestes, wie es am Todestag des Helden auf Caprera gefeiert zu werden pflegt, ist ein Merkmal für die Tiefe des Gefühls, welches Italien für seinen großen Toten bewahrt. Das Fest bietet von allen den äußerlichen Anziehungsmitteln, die in den Anordnungen moderner Festwut eine Hauptrolle spielen, gar nichts. Leibliche Genüsse und Vergnügungen, die in der übrigen Welt auch bei einem ernsten Feste nicht fehlen dürfen, scheiden hier aus der Berechnung völlig aus. Die ganze Pilgerfahrt nach Caprera ist für den Teilnehmer mehr ein Opfer als ein Genuß. Aber Hunderte bringen dieses Opfer, unterziehen sich den Beschwerden einer langen Eisenbahn- und Seefahrt bis zu dem abgelegenen Inselchen, wo der Begriff der Verpflegung im Touristensinne überhaupt nicht mehr vorkommt, klettern im Sonnenbrand die steilen Felsenwege von Maddalena bis nach Caprera hinauf, um am Grabe Garibaldis einen Kranz niederzulegen und am Anblick der mancherlei Reliquien seines lekten Wohnsikes das vaterländische Gefühl zu erwärmen; und nach einem heißen, hungrigen und durstigen Tage kehren sie an Bord zurück, wo die Tafelmusik mit der Garibaldihymne sie über die Mängel der Tafel selbst hinwegtäuscht, und wo sie gleich zusammengepferchten Schafen auf oder unter Deck eine schlaflose Nacht zubringen. Aber leuchtenden Auges ziehen sie am anderen oder am dritten Tage wieder in ihren Heimatsort ein, voll von dem Hochgefühl einer wohlvollbrachten vaterländischen Pflicht. Ich schloß mich denen an, die aus Mittelitalien in Civitavecchia zusammenströmten, um dort mit zwei Dampfern der Navigazione Generale nach Maddalena überzufahren. Außer den eigentlichen Garibaldinern, die mit ihren Vereinsfahnen und zum Teil mit eigenen Musikbanden eintrafen, fuhren noch zahlreiche Abgeordnete und Beamte von da und dort als offizielle Vertretungen bei der zehnjährigen Gedenkfeier mit, unter anderen die Radikalen Cavallotti, Barzilai, Pais-Serra, dann zahlreiche Vertreter der Presse und sonstige Verehrer Garibaldis aus allen Ständen, die, ohne selbst das rote Hemd getragen zu haben, doch den Zoll vaterländischer Verehrung an seinem Grabe darbringen wollten. Es war eine mehr als tausendköpfige bunte Reisegesellschaft, viele in der leuchtenden Freischarenuniform, die Brust mit Medaillen bedeckt, an der Seite den Brotbeutel und die Feldflasche, beide wohlgefüllt, als ob es ins Feld ginge. Mit liebevoller Sorgfalt bewachten manche unter ihnen ein Gepäckstück von riesenhaftem Umfang und der Form eines Wagenrades; es war der Kasten, der den frischen Kranz für das Grab des Helden barg.
Gleich den beiden überfüllten Dampfern, die von Civitavecchia abfuhren, liefen noch welche von Genua, Livorno, Neapel und für die Insulaner von Palermo und Porto Torres (Sardinien) aus, und diese ganze stattliche Flottille traf sich am frühen Morgen des 2. Juni in den Gewässern um Maddalena. Wie ein breiter Binnensee liegt dort das glänzende Meer eingeschlossen zwischen der sardinischen Nordküste, den Inselchen S. Stefano, Maddalena und Caprera, von deren hellen Kalkfelsen herunter heutzutage die Kanonen dräuen, denn das ganze Küstengebiet an der Straße von Bonifazio ist seit einigen Jahren in eine gewaltige Seefestung verwandelt. In die Felshöhen sind Batterien und Forts hineingebaut, und im Meeresgrunde lauern die Torpedos. Ein gläubiger Garibaldiner, der unter anderem auch den köstlichen Ausspruch that, San Garibaldi habe für den Gedenktag gutes Wetter geschickt, erklärte mir bereitwillig, der ganze Plan der gegen Frankreich gerichteten Befestigungen stamme von Garibaldi selber, der sich zu diesem Zwecke auf die Insel Caprera zurückgezogen habe. Ich wagte natürlich nicht zu widersprechen. Es war noch nicht acht Uhr morgens, als ich auf einer kleinen, zur italienischen Marinestation gehörigen Dampfjolle ans Land fuhr und dann an der Küste entlang zwischen Werften und Kasernen her den heißen staubigen Weg nach dem Damm und der Brücke einschlug, welche gegenwärtig Caprera mit Maddalena verbinden. Die Meerenge ist hier nur einen halben Kilometer breit und das Wasser noch nicht 4 Meter tief. Das Ziel der Wanderung leuchtet von weit her schon in die Augen, jenes niedrige weiße Haus mit dem runden Türmchen, das zwischen grauen Felsklözen und dunklem Laub am Abhang liegt, während höher hinauf wie ewige Wächter scharfgezackte Felsgrate bis zu 200 Meter in die blaue Lust ragen.
Der Pfad, der sich zwischen wunderlich geformten Felsen, blühendem Thymian und immergrünem Gestrüpp hinaufwindet, von würzigem Duft umweht und heute mit flatternden Fähnchen geschmückt, führt in zwanzig Minuten von dem Damm zu Garibaldis Haus, um welches auch vom Winde gebläht die dreifarbigen Banner wehen. Einen noch schöneren Festschmuck aber bilden die Menschen, die aus den nächsten Küstenorten zu Hunderten hier zusammengeströmt sind, um die Ankunft der Garibaldinervereine abzuwarten. Geduldig liegen sie im Sonnenschein um das Haus herum oder im Schatten eines Felsens oder eines Delbaums, verzehren, was sie mitgeschleppt haben, Brot, Eier, Orangen, und trinken sardischen Wein dazu; viele sind in althergebrachter Nationaltracht, die Männer schwarz und weiß oder sonst in dunkeln Farben, den Kopf mit der langen Sackmüze bedeckt, die Frauen in bunten, meist seidenen und samtenen Gewändern, den Aermelschliz mit silbernen Kugeln geschmückt, überm schwarzen Haar einen weißen Spizenschleier, der bis über das violettfarbene Samtmieder und den feingefältelten roten oder schwarzen Rock herabfällt. Sie haben in den ersten Morgenstunden bereits das Haus und Grab des Nationalhelden besucht und rasten nun, bis die Feier beginnt. An den Eingängen des schlichten Hauses halten Veteranen in der roten Bluse die Ehrenwache, an den Fenstern der Wohnräume zeigt sich ab und zu ein Familienmitglied, Menotti Garibaldi, seine Schwester Teresita und deren Gatte Stefano Canzio, die schon am Tage zuvor herübergekommen sind, um das Andenken ihres Toten zu ehren.
Die Familie hat ihm vor einigen Jahren ein würdiges Denkmal gesekt, auf dem freien Plak vor dem Hause, die benachbarten grauen Felsen überragend, eine gewaltige Büste aus weißem Marmor, die weithin sichtbar ist. Der schöne bärtige Kopf zeigt einen milden Ausdruck, wie er dem Greise eigen war; die Arme halten über der Brust den Mantel zusammen. Viele andere Bilder Garibaldis aus verschiedenen Lebensaltern sind im Innern des Hauses zu sehen, wo in drei Räumen mancherlei Andenken gesammelt sind. Durch einen kleinen Garten, in dem aus dichtem grünen Laub feuerrote Geranien, des Helden Lieblingsblumen, leuchten, betritt man das einfache Gebäude. Es scheint neuerdings nicht gut unterhalten zu werden, denn gerade während der heutigen Feier stürzte der Fußboden eines Zimmers ein, in welchem sich gegen dreißig Besucher befanden; schwere Verlegungen sind zum Glück dabei nicht vorgekommen. Von der freien Fläche vor dem Hause, die 40 Meter über dem Meer gelegen einen freien Umblick über den ganzen Sund und nach S. Stefano und Maddalena hinüber gewährt, schaute ich dem Anmarsch der Garibaldiner zu, die sich auf der Nachbarinsel geordnet hatten und nun in langem Zuge über die Brücke und den schmalen Weg heraufkamen. Die roten Hemden und Müzen leuchteten herüber wie die Geranien in den Gartenbeeten, die Fahnen wehten im Wind, und die berauschenden Klänge der Garibaldihymne zogen mit der balsamischen Luft über Felsen und Meer.
Die eigentliche Feier am Grabe bestand in zwei Reden der Abgeordneten Pais und Cavallotti und in der Niederlegung von Kränzen. Während die Garibaldihymne triumphierend in den sonnigen Tag hinausschallte und hundert Fahnen in dem Oliventhälchen hinter dem Hause wehten, bedeckte sich das Grab mit einer schier unermeßlichen Fülle von Blumen; es sollen mehr als 200 Kränze, meist von mächtigem Umfang, niedergelegt worden sein. Kaum ragte nachher noch die weiße Marmorurne aus dem Berg von Blüten hervor, die den als Grabstein dienenden Granitblock völlig mit ihrer duftenden Pracht verdeckten. Von der Grabstätte am Rande des Oliventhals kehrte ich wieder in die Erinnerungszimmer zurück. Sie enthalten viel Fesselndes, was in schweigender Andacht von Tausenden, die im Laufe des Tages hindurch wanderten, betrachtet wurde; Waffen, Bilder, Ehrenurkunden, Kränze mit Widmungen hervorragender Personen. Im Sterbezimmer steht inmitten das schlichte eiserne Bett, an der Wand hängt noch der Abreißkalender mit dem vergilbten Blatt des 2. Juni 1882. Ein treffliches Bildnis Mazzinis schmückt eine der Wände. Zu allen diesen Erinnerungen aus dem. Leben des Helden würde eine kleine Reliquie passen, die ich bei einem 90jährigen Verehrer Garibaldis in Rom gesehen habe. Es ist ein kleines rot und weiß geschliffenes Trinkglas mit dem Bild von Pillniz und hat folgende sehr charakteristische Geschichte. Vor einer seiner Unternehmungen gegen die italienischen Tyrannen traf Garibaldi mit einer Hamburger Dame zusammen, die ihn schon einmal mit großen Summen unterstüßt und ihm noch eine weitere Spende zugesagt hatte. Aber die Dame konnte ihr Wort nicht einlösen, weil ihr von seiten ihres Gatten Widerstand bereitet wurde. Und während sie das ihrem Freunde zu erklären versuchte, bewirtete sie ihn mit einem Glase Wein. Aber -man spricht vergebens viel, um zu versagen, der andere hört von allem nur das Nein. Garibaldi sah mit dem Verlust der versprochenen Summe schon sein ganzes Werk gefährdet, und in einer Anwandlung von unbändigem Ingrimm biß er aus dem Glase, das er an den Mund führte, ein Stück des Randes heraus. Echt garibaldinisch, nicht als glühendes Temperament und ungezügelter Trok! Das zerbissene Glas ist eine prächtige Illustration zu der Charakteristik, die Massimo d’Azeglio von Garibaldi gegeben: der Mann mit dem Kinderherzen und der Büffelstirn. Aber gerade diese Stirn, diesen trokigen Mut, der mit zäher Kraft jedes Hindernis zerstört, brauchte der Mann, um das nationale Werk auszuführen, um dessentwillen Italien ihn für alle Zeiten dankbar verehrt.
* PFINGSTTAGE IN SARDINIEN
LA MADDALENA
Ich wollte von der Gedächtnisfeier nicht nach Rom zurückkehren, ohne etwas von dem nahen Sardinien gesehen zu haben. Denn alles, was man von diesem eigenartigen Lande hört, reizt in hohem Maße die Begier nach näherer Bekanntschaft. Die Zeitungen bringen öfters Berichte über unglaublich kühne Brigantenstreiche von dort, in der Deputiertenkammer folgt dann eine Anfrage über den Stand der öffentlichen Sicherheit auf der Insel, der von allen Parteien und von der Regierung selbst als unerträglich anerkannt wird; das sind Dinge, die die Neugierde erwecken, wenn sie auch zugleich zur Vorsicht mahnen. Ich hatte mir daher schon in Rom für alle Fälle einen Revolver in die Tasche gesteckt, meinen Ranzen mit dem Bedarf für einige Tage und etlichem Malgerät gepackt und mich aus Bädeker überzeugt, daß man zu Anfang Juni Sardinien noch recht wohl bereisen kann, ohne am Fieber umzukommen. Am Nachmittag des 2. Juni sagte ich dem Hause Garibaldis lebewohl und wanderte, während die Sonnenstrahlen wie Pfeile herniederstachen, nach Maddalena. Das Städtchen auf der gleichnamigen Insel war bis vor wenigen Jahren noch ein ganz unbedeutendes, fast nur von Fischern bewohntes Dorf mit kleinen niedrigen Häusern. Seit die Italiener es zum Mittelpunkt ihrer dortigen Seefestung gemacht und eine Besakung hineingelegt haben, ist das unscheinbare Fischernest einigermaßen von der Kultur beleckt worden. Nach der Seite des Hafens und der Kasernen hin sind einige Straßen mit neuen, mehrstöckigen Häusern entstanden, Geschäfte und Kaffeehäuser, wo die Offiziere der Garnison sich mit dem Nüßlichen wie mit dem Angenehmen versehen können, aber für den Fremden ist so gut wie gar nicht gesorgt, denn es kommt auch nie einer dahin. Schon die Frage der Nachtherberge bot einige Schwierigkeiten. Ich durchwanderte die Straßen, die wie in ganz Sardinien einen charakteristischen Geruch nach Wein, Käse und Ziegenfellen aufweisen, und suchte vergebens nach einem Albergo.
Nach verschiedenen nuklosen Fragen führte mich ein schwarzbärtiger Geselle zu einem kleinen Hause am Ende des Ortes; es hatte eine Thür und zwei Fenster und enthielt zwei Räume. Der eine davon diente der Familie für alles, der andere war das „möblierte Zimmer“. Hier sollte ich in Gesellschaft eines Arbeiters vom Marinearsenal nächtigen. Da ich diesen wackeren Cyklopen aber von Haut und Haar nicht kannte, noch weniger sein Glaubensbekenntnis in Bezug auf Reinlichkeit, Ehrlichkeit und Nächstenliebe, so machte ich eine saure Miene und zog vor, von neuem auf die Suche zu gehen. Beiläufig gesagt habe ich schon am Tag darauf meine Ansprüche bedeutend herabgesekt und meinen Kulturmenschenleib nach der sardischen Decke gestreckt. Nachdem ich noch eine weitere halbe Stunde die heißen Gassen von Maddalena unsicher gemacht hatte, verriet mir der Apotheker, den ich als den gebildetsten Mann des Ortes um Rat fragte, daß es in der That Pfingsttage in Sardinien ein Gasthaus im Ort gab, genannt Scala di Ferro. Mit einem „Dank, wackerer Apotheker! “ schlug ich mich um so viel Ecken links und rechts, wie er mir angegeben hatte, und stand endlich in einem verlorenen Winkel hinter der Kirche vor dem gastlichen Hause. In dem dunklen Vorderzimmer schlief ein Mann, der mit dem Notwendigsten bekleidet war. Es war der Wirt. Nachdem ich ihn geweckt und um ein Zimmer gefragt hatte, entgegnete er, das werde sich finden, und führte mich in den Hausflur zurück. Dort ließ er mich stehen und sich an einem Tischchen nieder, holte Feder und Papier aus der Schublade und fragte mich nach Namen, Stand, Alter und was sonst der Steckbrief zu enthalten pflegt. Sardische Gastfreundschaft hatte ich mir anders vorgestellt, aber ich beantwortete die neun Fragen wahrheitsgetreu, fügte auch hinzu, daß ich in Caprera das Andenken Garibaldis gefeiert hatte, und wurde dann für würdig befunden, in dem Zimmer Nr. 1 die Nacht zuzubringen.
Als ich am anderen Morgen nach dem Frühstück verlangte, wurde mir bedeutet, daß das Haus auf Verköstigung nicht eingerichtet sei, und daß ich mich vielmehr ins Café Nazionale verfügen möchte. Es ging gegen sieben Uhr morgens, und in besagtem Café war man gerade beschäftigt, das Gastzimmer zu kehren, wo bis zum späten Abend vorher die Garibaldiner gezecht hatten, ehe sie die Heimfahrt antraten. Nach einigem ungeduldigen Warten erhielt ich eine Tasse Kaffee, aber Brot hatte man nicht. Das Unvermeidliche mit Würde tragen ist auf Reisen ein wichtiger Grundsak. Ich trank meinen Kaffee und kaufte da nach auf der Straße ein Pfund köstlicher Kirschen. Es geht auch so.
* GIORNI DI PENTECOSTE IN SARDEGNA (1892)
PALAU
Um 8 Uhr saß ich mit meinem Bündel in einem kleinen Segelboot und fuhr nach dem 4 Kilometer entfernten Palau an der Nordküste Sardiniens hinüber. Die Fahrt war ungemein reizvoll. Die Häuser von Maddalena lagen wie bunte Perlen am Felsufer; der Ort sieht von außen viel schöner aus, als er innen ist. Das stille blinkende Meer war ringsum von grauen Kalkfelsen wie von Riesenmauern umgeben, auf ihren Gipfeln glänzten die rötlichen Mauern der Befestigungen in der Sonne, unten in der glatten Flut spiegelten ein paar Kriegsschiffe ihre mächtigen Leiber.
Die sardische Küste steigt aus einem Kranz von niedrigen Klippen mit grünen Abhängen aus dem Meere auf, ein paar weiße Häuser winken vom Strande, das ist Palau oder Parau hoch darüber zackt sich in abenteuerlichen Formen das Kalkgebirge, das ehedem wohl mit dem korsischen zusammenhing. Unter den Felsprofilen ist eines besonders bemerkenswert; es sieht genau so aus, als ob da oben 100 Meter über dem Meer ein gewaltiger Bär stünde, der mit dem vorgebeugten Kopfe nach dem benachbarten Korsika hinüber wittert. Man nennt den Punkt daher auch Capo dell‘ Orso, Bärenberg. Auf seiner Spike wie auf dem nahen Monte Altura sind neuerdings Forts angelegt. Die Franzosen würden sich hier wohl nuklos die Köpfe einrennen, wenn sie einmal versuchen wollten, über die Meerenge von Bonifazio herüber zu kommen. Nach einstündiger Fahrt landete ich in Palau. Der Strand ist schwarz 一, von den Holzkohlen, die aus dem inneren Bergland kommend hier verladen werden; darin besteht wohl auch der einzige Verkehr an dieser Stelle. Der Plaz besteht höchstens aus einem Dukend Häuser, darunter einem Kramladen, der zugleich Kneipe und Albergo ist.
Das Haus schien nicht sehr vertrauenswürdig; ich zog daher vor, nicht den Postwagen abzuwarten, der am folgenden Morgen 6 Uhr nach Tempio abgehen sollte, sondern mietete einen Mann mit einem Pferde, einen viandante, der seines Zeichens Schuhmacher war, Michele Uliva hieß und mir versprach, mich vor Abend in Tempio abzuliefern, wohin eine 50 Kilometer lange Fahrstraße führt. Es sollten etwa 9 Stunden Reitens sein, die Ruhepausen eingerechnet. Aber den Weg hatte der Fuchs gemessen!
AUF DEM WEG NACH TEMPIO
Um halb 10 Uhr ritten wir auf einer guten Straße, die in einem malerischen Flußthal ansteigt, landeinwärts. Hat man nach einstündigem Ritt die Höhe erreicht, so breitet sich vor dem rückschauenden Auge ein herrlicher Rundblick aus. Im Vordergrund eine Felswildnis, mit immergrünem Gestrüpp und duftenden Kräutern bedeckt; dazwischen wächst in breiten Lappen eine zierliche Saxifrageenart mit purpurroten Stengeln und hellvioletten Blüten. Tiefblau liegt unten das Meer hinter den mauergekrönten Vorgebirgen, von Klippen und Inselchen besäet, den großartigen Hintergrund bildet Korsika mit himmelanstrebenden, zum Teil noch schneebedeckten Bergen, an deren Fuß im Sonnenglanz die weißen Häuser von Bonifazio liegen.
Indem Michele Uliva mir die Aussicht erläuterte, machte er im Hinblick auf das – gegenüberliegende Frankreich – wie er es nannte eine politische Abschweisung, aus der mir ersichtlich wurde, daß seine Freundschaft für die lateinische Schwesternation nicht eben groß war. Michele war Sarde mit Leib und Seele. Er trug zwar nicht mehr das heimische Kostüm, und man hätte ihn seinem Aeußern nach auch für einen deutschen Schuster halten können, aber sein Herz war unverfälscht sardisch. Wenn er nicht plauderte oder trank, sang er mir heimatliche Lieder vor. Besonders zwei waren es, die er nicht müde wurde zu wiederholen. Das eine stellte den Lebensgang einer Jungfrau dar, die vergebens auf einen Gatten wartet. Quarantacinqu’anni, marito non c’è; cinquant’anni, si ammazzerà (Mit 45 Jahren kein Gatte, mit 50 bringt sie sich um). Das war der melancholische Schluß, von dem ich hoffe, daß er nicht auf einen sardischen Nationalgebrauch anspielt. Das zweite Lieblingslied meines Führers gipfelte in den Worten: Sono in Africa prigioniero, ma quando tornerò, vedrai Marietta mia, come ti posso amar‘! (Ich bin in Afrika gefangen, aber kehr‘ ich zurück, so sollst du sehen, Maria, wie ich dich lieben kann.)
Das sang er so innig und schmachtend, wie ein verliebter Bursch von zwanzig Jahren, obwohl er, wie ich später erfuhr, bereits Großvater war. Er hatte in der Gegend zwischen Tempio und der Nordküste, der sogenannten Gallura, zwei oder drei Töchter verheiratet; und das war auch der Grund, weshalb ich an dem Abend nicht mehr nach Tempio kam. Zu den sonstigen hervorstechenden Charaktereigenschaften Micheles gehörte, daß er gotteslästerlich fluchen konnte, aber ohne es böse zu meinen. Statt der Bejahungen, Versicherungen oder Verneinungen hatte er einen reichen Vorrat von Flüchen im Gebrauch, die ich nicht zu übersehen wage, von deren Anwendung aber folgende Unterhaltung einen ungefähren Begriff gibt. Ich sage: „Es ist tüchtig heiß heute.“ Er: „Dio cane! Es ist immer heiß bei uns.“ Ich finde die Aussicht schön. Er erwidert: „Porca madonna! Sardinien ist ein prächtiges Land.“ Mit seinem Pferde sprach er viel höflicher, da fluchte er nie; seine Stimme hatte vielmehr einen herzlichen Klang, wenn er dem ausdauernden kleinen Tiere ermunternd zurief: „Anda cava‘! ah carino! “ (Sardisch für Va cavallo; auf Deutsch: Lauf, mein Gäulchen, mein gutes!) Das Pferd that sein Bestes auf der steilen heißen Straße, und anfangs kamen wir rasch voran.
Die Gegend war menschenleer; zwischen Palau und Tempio liegt nicht ein einziges Dorf, nur etwa gut gezählt – ein Dukend einzelne Häuser oder Hütten an den Berghängen zerstreut. Entgegen kamen uns alles in allem im Lauf eines ganzen Tages drei oder vier Ochsenwagen mit Kohlensäcken und ein paar einzelne Reiter in der düsteren Nationaltracht mit der Büchse auf dem Rücken, dazu eine Bäuerin, die mit zwei Kindern rittlings zu Pferde saß. Dieser ganze nördlichste Teil der Insel ist gleich anderen fast gar nicht angebaut; Thäler und Höhen dienen höchstens als Weideland. Während die höchsten bis zu 400 und 500 Meter ansteigenden Gipfel schroff und kahl sind, grünt es an den tieferen Abhängen und in den Thälern zwischen dem Felsgeröll üppig von Baum und Strauch. Aber jekt im Sommer winden sich nur schmale silberne Wasserfäden durch die Thalsohle, und legten nicht eingestürzte steinerne Brücken Zeugnis ab von der Gewalt des Wassers im Winter, so würde man an die Anwesenheit von Flüssen in jenem Bergland nicht glauben. Noch im vergangenen Jahre hat der Fluß Liscia, den wir mehrmals überschreiten mußten, mit seinen Zuflüssen in fürchterlichem Hochwasser Häuser, Brücken und Straßen zerstört. Gegenwärtig versteckte er sich fast unter Steinen und Laub.
Aber trok der sengenden Hize finden sich hie und da im Schatten von Lorbeergebüsch und Delbäumen frische Quellen am Wege. An jeder wird Rast gemacht und Mensch und Tier erquickt. Neben den meisten Quellen liegt auf dem Steinrand zum Gebrauch des Menschen ein lupo, den ein gutmütiger Nachbar zu allgemeiner Verwendung gestistet hat. Der lupo ist ein aus Korkrinde notdürftig zusammengebogener Schöpfbecher an einem Holzstiel; er ist nicht wasserdicht, und trinkt man nicht rasch, so rinnt einem das Wasser aus allen Fugen davon wie aus dem Faß der Danaiden. Aber außer dem Wasser nimmt der vorsichtige Führer noch einen anderen Trunk mit, den schweren sardischen Rotwein, der wie Feuer durch die Adern rinnt, und dessen Strenge durch eine süße Blume gemildert wird. Michele Uliva sorgte schon im eigenen Interesse dafür, daß uns der Wein nicht ausging. Zwei Stunden oberhalb Palau lag abseits vom Wege seine Behausung, ein einstöckiges Haus, das einen einzigen Raum enthielt, mit einer Thüre und einem Fenster. Auf dem Feuer, das mitten in dem Raum in einer runden Vertiefung des festgestampsten Erdbodens brennt, bereitete seine Frau die aus Palau mitgebrachten Nudeln, die wir mit trefflichem Brot verzehrten.
Die zucca, ein aus einer langen ausgehöhlten Melone gefertigtes Trinkgefäß, ging von Mund zu Mund, und was wir von Rotem darinnen ließen, das füllte er in eine kleinere kugelrunde zucca für die Reise.
Nach einstündiger Rast ging es weiter bergan, indes wir als erfrischenden Nachtisch die mitgenommenen rohen Salatblätter verzehrten. Michele war des Gehens müde und setzte sich hinter mich auf den Gaul; das Tier schwiste, daß unsere Beinkleider trieften, aber es trabte unverdrossen weiter, und mein Führer sang und plauderte, daß es eine Lust war. Gegen 5 Uhr gestand er mir, daß er Sehnsucht nach seiner Tochter hatte, die einige Minuten abseits vom Wege in einem stazzo (einsam liegende Bauernhütte) wohnte. Die zucca war nämlich leer. Unter der Bedingung, daß wir vor Abend in Tempio wären, willigte ich ein, der Tochter einen Besuch zu machen. Das Häuschen war verschlossen, und Michele rief laut über Berg und Thal: Oh Caterìi! Aber Katharina antwortete nicht. So öffnete er selbst mit irgend einem Kunstgriff die Thüre, und wir traten aus dem glühenden Sonnenschein in das erfrischende Dunkel unter dem Binsendach. Der Führer wußte hier Bescheid; er fand Teller, Löffel und mizzurata, eine Art dicke noch nicht saure Milch.
Wir hatten kaum das erquickende Mahl beendigt, so erschienen Tochter, Schwiegersohn, Kind und Großmutter. Sie hatten unten am Bach große Wäsche gehalten und freuten sich des unerwarteten Besuchs. Nun mußten wir natürlich noch verweilen, die zucca wurde frisch gefüllt, und ich sollte dem glücklichen Großpapa Michele die Freude bereiten, das junge Paar mit dem halbjährigen Kind in mein Skizzenbuch zu zeichnen. Die junge Mutter nahm zu diesem Zweck den Säugling an die Brust, so daß er prächtig still hielt, und ich zeichnete.
Erst nach 6 Uhr traten wir die Weiterreise an, ich immer noch in der Hoffnung, zum Abendessen in Tempio zu sein. Aber die väterliche Liebe Micheles hatte es anders beschlossen. Als wir abends um 8 Uhr die Sonne war schon hinter den Bergen verschwunden – auf die Wasserscheide zwischen den Flüssen Liscia und Rio di Vignola kamen, von wo man in weiter Ferne Tempio zum erstenmal sieht, da gestand mir mein Führer, daß wir vor Mitternacht kaum am Ziele sein könnten; dagegen wäre es möglich, etwa gegen 10 Uhr Luras zu erreichen, wenn wir die Fahrstraße verließen und links ins Thal hinunter ritten. Was war zu thun? Ich sehnte mich nach dem Nachtlager und willigte ein, nach Luras zu gehen, wo der gute Michele auch eine Tochter verheiratet hatte.
Nun ging es auf steilen, steinigen Wegen bergab, bergauf. Die Nacht brach an, und der Mond kam herauf; er war noch nicht voll, aber er erhellte die großartige Bergwildnis, daß es wie Silber darüber lag. Die unendlich klare Luft glänzte über den scharfen Bergkanten und den dunkeln Baumgruppen, und der Abendstern leuchtete so hell, wie ich ihn nie gesehen; er glich einem einsamen Feuerzeichen. In den Wiesen ringsum zirpten die Grillen zu Hunderten, und wenn wir durch einen Bach ritten, so flohen im Schatten flinke Pferde davon, die von der Weide zum Abendtrunk gekommen waren. Am Wege schlief auf einer Karre ein Bauer; er war der einzige Mensch, den wir bis halb 11 Uhr, als wir in Luras anlangten, noch zu Gesicht bekamen. Sonst umgab uns nur die feierliche Landschaft mit ihrem nächtlichen Tierleben.
Ein fernes schrilles Brausen, das seltsam durch das Dunkel schallte, zog plötzlich meine Aufmerksamkeit an, und ich fragte den Führer danach. Statt aller Antwort fragte er mich, ob ich Furcht hätte, was ich mit dem absichtlichen Zusak verneinte, daß in meiner Tasche, auf der ich die Hand hielt, ein geladener Revolver stecke.
Furcht hatte ich auch nicht, aber es war ein eigenes fremdartiges Gefühl in mir, Freude einerseits an der großen, ernsten Natur, die mich umgab, und eine scheue Neugierde andererseits nach einer unbekannten Zukunft, der ich entgegenritt. Michele versicherte mich hierauf mit großer Wärme, er sei mein Freund, und ich brauche nichts zu fürchten; Briganten gebe es in der Gallura nicht, die seien nur oben im Hochland von Bitti und Nuoro, und das stärker werdende Geräusch sei nur das Rauschen eines Wasserfalles, den der Fluß Liscia bildet. So war es auch. Wir überschritten das Bergwasser zum drittenmal und kamen um 10 Uhr in eine Gegend von neuem Charakter. Mächtige Korkeichen standen finster am Wege, dann wechselten Weinberge mit Feigen- und Olivenpflanzungen, wir näherten uns dem Dorf Luras. Die weißgekalkten Wände der niedrigen Häuser leuchteten im Mondschein durch das zierliche Laub der Delbäume, die Hunde schlugen an, und über ein Pflaster, das nicht besser war als das Steingeröll der Felsenpfade, ritt ich in die schwarzen Schatten der Gassen hinein.
LURAS
Ich kam mir vor, wie der edele Ritter Don Quixote von der Mancha, von dem Cervantes irgendwo auch einmal erzählt, wie er in einer Mondnacht mit seinem Schildknappen Sancho in ein fremdes geheimnisvolles Dorf gekommen. Mein treuer Sancho sorgte nach besten Kräften für mich. Er fand eine Schenke, deren Insassen er herausklopfte, erzählte ihnen, was für ein Menschenkind ich sei, und daß ich übernachten wolle, und nach einigen Minuten saßen wir am Tisch vor einem Gericht, welches ich mit Behagen verzehrte, von dem ich aber heute noch keine Ahnung habe, was es war. Dann gingen wir zu Bett. Ueber meinem Lager hing das Gewehr des Hausherrn, auf einen Strohsack in der Ecke streckte sich Michele Uliva, und obwohl er schnarchte, wie die Walkmühlen im Don Quixote, so schlief auch ich bald den Schlaf des Gerechten, ohne vorher zu fragen, ob das Bettzeug frisch und ob die Thür verschlossen war. Ich war schon nicht mehr so peinlich wie tags zuvor.
Das Haus, in dem ich in Luras übernachtete, war allerdings zweistöckig, aber sonst so urwüchsig und einfach wie seine Kameraden. Glasfenster hatte es nicht, die Fensteröffnungen waren nur mit Holz läden verschließbar; außer dem Fenster war in unserem Zimmer noch eine Balkonthüre, die die Nacht über halb offen blieb, weil sie überhaupt nicht fest zu schließen war; der Balkon bestand aus einer um einen halben Meter vorspringenden Steinplatte, sein Geländer aus einem Strick.
Der Fußboden des oberen Stockwerks war aus rohen Balken mit einer einzigen Bretterlage hergestellt, so daß man durch die Dielenriken, die zum Teil eine ansehnliche Breite hatten, aus einem Stockwerk ins andere sehen konnte. Von diesem und ähnlichem überzeugte ich mich, als ich in der Morgendämmerung gegen 4 Uhr mich erhob und reisefertig machte, um den Frühzug der Nebenbahn Tempio-Monti nicht zu versäumen, der mich auf die sardische Hauptbahn Golfo degli Aranci- Cagliari bringen sollte.
Auf dieser Nebenbahn gehen den ganzen Tag über nur zwei Züge in jeder Richtung und auf der Hauptbahn nur ein durchlaufender, so daß man wohl aufpassen muß, um die seltene Gelegenheit nicht zu versäumen. Da ich am Abend zuvor schon hatte die Zeche berichtigen müssen, eine Lira für Speise, Trank und Nachtlager, so hielt mich am Morgen niemand mehr in dem Wirtshaus auf, nicht einmal, um mir Waschwasser zu bringen; auch ein Spiegel war nicht vorhanden.
So nahm ich denn ohne viele Umstände an, daß ich für sardische Verhältnisse anständig genug aussähe, drückte dem halbwachen Michele, der wohl von dem Wiedersehen mit seiner Tochter träumte, die Hand zum Abschied und verließ das gastliche Gemach. Im Halbdunkel des Vorzimmers stolperte ich über einige Beine; hier schliesen fünf Kerle auf dem Fußboden. Ich huschte nach der steinernen Treppe, rutschte in den dunkeln Hausflur hinunter, tastete an der Hausthür hin und her, bis sie sich auf einen glücklichen Griff öffnete, und stand aufatmend im Freien. Es war doch ein gar sonderbares Nachtquartier gewesen. Durch den frischen Morgen wanderte ich dann zwischen Weingärten und Korkeichenwald nach der eine gute halbe Stunde entfernten Station, wo ich am Brunnen meine nachträgliche Morgenwäsche hielt.
AUF DEM WEG NACH CAGLIARI
ABREISE VON MONTI
Die Bahn nach Monti führt in zahllosen Windungen an zerklüfteten Kalkfelsen bergab; an einer Stelle öffnet sich ein herrlicher Blick auf den um 25 Kilometer östlicher liegenden Orangengolf, von dem die tägliche Postdampferverbindung nach Civitavecchia geht.
Monti selber liegt in einem hübschen Flußthal zwischen dem nördlichen Kalkgebirge der Gallura und dem Granithochland von Bitti und Nuoro, von wo man südlich weiter hinauf steigt nach der höchsten Erhebung der Insel, dem Monte Gennargentu. Ich überzeugte mich bald mit eigenen Augen, daß Michel Uliva diese Gegend mit Recht als das Banditenheim bezeichnet hatte, denn auf dem Bahnhof Monti wartete mit mir auf den Zug ein Trupp Carabinieri, die zwei verwegene Gesellen mit Handschellen bewachten. Ich erfuhr, daß diese dunklen Ehrenmänner einer Bande angehörten, die vor einigen Tagen da oben aufgespürt worden war, und der man außer anderen Heldenthaten auch den berühmten vor Jahresfrist verübten Ueberfall der Eisenbahnstation Chilivani zuschrieb, wo sie die Stationskasse und die Kasse des Buffettwirtes geleert hatte. Hier scheint mir eine Bemerkung über die öffentliche Sicherheit Sardiniens am Plaz.
Ich habe den Eindruck gewonnen, daß die Ehrlichkeit auf der Insel im allgemeinen höher steht als im festländischen Italien; ich bin weder angebettelt noch übervorteilt worden. Aber infolge der unglücklichen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse blüht in vielen Gegenden Sardiniens noch ein mit einer gewissen Ritterlichkeit geübtes Banditentum, in dessen Schatten sich aber auch ein mit wilder Rohheit und skrupelloser Gemeinheit betriebenes Wegelagerertum eingenistet hat. Der Fremde jedoch hat nichts zu fürchten, wenn er nicht Geld und Wertsachen in auffallender Weise sehen läßt. Die Unternehmungslust der sardischen malfattori richtet sich vielmehr mit Vorliebe gegen öffentliche Kassen, gegen verhaßte Grundbesiker und andere als reich bekannte Ansässige samt deren Anhang, gegen deren einzelstehende Gehöfte, Feldarbeiter und Viehherden, sowie endlich gegen die Sicherheitsbehörden selbst. In den lekten drei Wochen sind unter anderen zwei größere Kämpfe zwischen Banditen und Carabinieri vorgefallen, der eine kurz vor meiner Ankunft in der Umgegend von Bitti, der andere während meines Aufenthalts in Sardinien bei Cagliari. In beiden Fällen wurden einige Carabinieri verwundet und getötet. Der Mangel an Verkehrswegen und die Spärlichkeit der Bevölkerung tragen natürlich auch dazu bei, das Unwesen zu fördern.
An Eisenbahnen besikt die Insel außer den schon genannten Linien noch zwei Hauptbahnen Chilivani-Sassari- Porto Torres und Decimomanu-Iglesias, dazu nur noch ein paar Nebenbahnen, von denen die bedeutendsten sind: Cagliari-Sorgono, Bosa-MacomerNuoro und Sassari-Alghero. Der Betrieb aller dieser Bahnen, insbesondere der Personenverkehr ist schwach; Sardinien steht noch nicht im Zeichen des Verkehrs. Man sieht es der Bevölkerung an, daß das Reisen auf der Eisenbahn ihr noch etwas sehr Ungewohntes ist; das Landvolk bekreuzt sich, ehe der Zug sich in Bewegung sekt, als ob man wer weiß welchen Gefahren entgegenginge. Auch rüsten sie sich für jede Fahrt von einigen Stunden mit Eßwaren und Getränk aus, als ob sie eine Tagereise zu machen hätten. Sie tragen diese Vorräte mit dem übrigen Gepäck in einem großen Doppelsack von buntgestreiftem grobem Wollenstoff, der sowohl über der Schulter getragen wie aufs Pferd gelegt werden kann.
Da während der Eisenbahnfahrt fast ununterbrochen gegessen und getrunken wird, so ist der Boden der Wagenabteile dritter Klasse stets mit einem dichten Abfallhaufen bedeckt, der an die schmutzigsten Gassen Alt-Neapels erinnert. An Ungeziefer jeder Art ist darum in den Eisenbahnwagen ebensowenig Mangel wie in den Gasthäusern. Solche Mängel der Kultur muß man geduldig mit in den Kauf nehmen, wenn man da drüben reisen und sich an den vielfachen Reizen des Landes und Volkstums erfreuen will, die meist gerade durch die Kulturlosigkeit bedingt sind. Im wirtschaftlichen Interesse der Bewohner muß man allerdings wünschen, daß es mit der Kulturlosigkeit ein Ende nähme, denn was könnte der Boden nicht alles tragen, wenn er sorgsam bearbeitet würde! Aber es fehlen, wie mir Michele Uliva wohl ganz richtig sagte, nicht nur die Hände, sondern auch die Gelder.
Auch in Sardinien bietet sich wie in so vielen anderen Teilen Italiens noch ein weites, weites Feld der Thätigkeit für die Leiter seiner Geschicke, wenn sie es wieder zu dem machen wollen, was es einmal war, zu einer gesegneten Kornkammer, einem granajo, wovon die Sarden selber noch mit Stolz und Wehmut zugleich reden. Gut angebaut sind überhaupt nur die üppi gen Fluren der Ebenen des Tirso und des Samassi zwischen Oristano und Cagliari. Auf der ganzen Fahrt von Monti bis weit über Macomer hinaus, etwa bis Baulladu, sieht man dagegen kaum ein Ackerfeld. Aber schön ist die Landschaft in ihrer Wildheit; in den Flußthälern grünt der Eichwald, an den sansten Abhängen und auf den Hochflächen dehnt sich Weideland aus, wo zwischen Felsgruppen, würzigen Kräutern und dichtem Buschwerk die Rinder und Pferde ohne Hirten grasen, während höher hinauf in den mächtigen Bergen, deren kühne Linien so klar durch die Luft ziehen, die Ziegenherde klettert.
Hie und da ragt in dem menschenleeren Bergland als Zeuge einer alten verschollenen Kultur eine Gruppe von Nuraghen, jenen seltsamen Türmen von der Form eines abgestumpften Kegels, die einer uralten Hirtenbevölkerung als Zuflucht gedient haben mögen. Dichtes Gestrüpp von Disteln und Dornen wuchert heute um ihre Eingänge, und über die schwarzen riesigen Mauersteine, die meist ohne Mörtel aufeinander geschichtet sind, kriechen rostgelbe Flechten.
Hinter Chilivani, wo die Bahn nach Sassari und Porto Torres abzweigt, steigt die Bahn in weiten Schlingen ins Hochland hinauf, wo in langen Zwischenräumen die kleinen Stationen Giave, Bonorva und Campeda liegen.
Hier oben hat neuerdings eine ausländische Gesellschaft begonnen, den Reichtum an Eichwald auszubeuten; aber leider treiben sie den reinen Raubbau. An Nachpflanzung denkt niemand, und so werden die Goldgruben bald erschöpft und mit dem Verschwinden des Waldes dem Klima wie dem Boden des Landes neue schwere Schäden zugefügt sein. Der Hauptverladeplak für die prächtigen Eichenbalken, die als Grubenhölzer in die Bergwerke oder als Eisenbahnschwellen nach Frankreich gehen, ist Campeda. Da entwickelt sich ein fesselndes Bild. Zu Dukenden kommen die kleinen plumpen, mit Holz beladenen Karren an, von zwei starken Ochsen gezogen. Die aus dicken Balken gefertigten Karren zeigen noch genau die Form, wie man sie auf antiken Darstellungen sieht. Nirgends eine Vorrichtung, um ein elastisches Fahren zu ermöglichen, alles hart und vierschrötig; die Räder sind meist ohne Speichen, eine massive dicke Holzscheibe mit einem Eisenreif. Um auf einem solchen Fuhrwerk ohne Verlegungen über die steinigen Wege zu fahren, muß man sardische Knochen haben.
Ein paar Fuhrknechte besteigen in Campeda den Zug; starke schöne Kerle mit braunen Gesichtern und verwegenen schwarzen Augen. Sie werfen mit Gepolter das Ochsenjoch unter die Bank, einen schweren Balken mit zwei Kerben für den Nacken der Tiere, und nehmen die Peitsche zwischen die Kniee, einen dicken Stecken mit einem Stachel an der Spike und einer vierkantigen Lederschnur. Ihre Tracht besteht aus der langen schwarzen Sackmüße, deren breiter Zipfel als Schirm gegen die Sonnenstrahlen vornüber gezogen die Stirn bedeckt, einer groben schwarzen Tuchjacke, deren Brustteile in schrägem Schnitt übereinander gelegt sind, und der bestighedda, einem ärmellosen Wams aus Ziegenfell, das vorn offen lose über der Jacke hängt und zu beiden Seiten eine kleine Tasche hat. Die behaarte Seite ist nach innen gekehrt, die Ränder sind mit einem dunkleren Lederstreifen eingefaßt; manchmal zeigen die unteren Ecken dieses Wamses neben den Taschen eine einfache Stickerei aus bunten Fäden. Die Beine stecken bei manchen in der modernen Langhose, viele tragen aber auch an den Beinen noch die sardische Nationaltracht, vom Gürtel abwärts zunächst einen rundum laufenden schwarzen vielgefältelten Tuchschurz, der bis in die Mitte der Schenkel reicht, darunter eine weite weißleinene Hose bis knapp unter die Kniee und dann dunkle Tuchgamaschen.
Der Hirte, der immer im Freien dem Sonnenbrand und jeder Unbill der Witterung ausgesekt ist, hängt statt der bestighedda ein langes zottiges Fell mit Armlöchern um, bald mit den Haaren, bald mit dem Leder nach außen, wie es ihm seine klimatische Erfahrung eingibt, und schüßt sich damit gegen Kälte, Hize und Fieber.
DIE MEISTEN REISEN IN SARDINIEN ERFOLGEN ZU PFERD
Die Satteltaschen, oder bisaccia, aus grober Wolle gehören ebenso zur Ausrüstung des Reiters wie der Sattel selbst. Im Hintergrund erhebt sich einer der Nuraghen – jene prähistorischen Ruinen, die die Insel übersäen.
SARDISCHE BAUERN BEI IHRER ANKUNFT IN MACOMER
Da die Pferde darauf trainiert sind, das doppelte Gewicht zu tragen, reiten die Frauen hinter den Männern. Die Sättel sind kunstvolle Arbeiten aus Leder in verschiedenen Farben, verziert mit Knochenknöpfen und Taschen. An der Seite befindet sich stets eine kleine Fußstütze für die Reiter.
MACOMER
Bei Macomer erreicht die Eisenbahn den Kamm der Catena del Marghine, 576 Meter ü. M., das Randgebirge der Hochebene von Mortas.
Das Städtchen liegt in malerischer Einsamkeit an felsigem Abhang, von verwitterten Nuraghen umgeben, und besikt eine moderne Sehenswürdigkeit: ein stattliches Gasthaus mit Restaurant dicht bei der Station. Hier findet man gute Zimmer mit Spiegeln, den einzigen, die ich im Innern der Insel gesehen habe; zum Ueberfluß liegen auf dem Waschtisch auch Kamm und Haarbürste, sie scheinen auch benukt zu werden. Das Haus ist von dem Engländer Piercey erbaut, der hier und in anderen Teilen der Insel Güter und Bergwerke besikt. Man hat von allen Punkten des Ortes herrliche weite Aussichten über die weite Thalebene des Flusses Tirso bis nach dem Campidano von Oristano hinunter, nach dem mächtigen breit hingelagerten Mittelgebirge der Insel, dessen Kamm die Spike des Monte Gennargentu fast 2000 Meter hoch überragt.
VOM MACOMER NACH ORISTANO
Von Macomer senkt sich die Bahn, zahlreiche schöne Flußthäler überschreitend, bis in die gesegnete Tiefebene hinab, die vom Golfo di Oristano bis zum Golfo di Cagliari einen Längenraum von nahezu 100 Kilometer bei einer Breite von durchschnittlich 20 Kilometer einnimmt. Dieser Campidano ist heute noch eine Kornkammer, wie es vordem der größere Teil der Insel gewesen.
Bei der Weiterfahrt kündigt sich nach und nach der afrikanische Charakter der üppigen Gefilde an. Die Grundstücke sind nicht mehr mit niedrigen Steinwällen, sondern mit Hecken von Feigenkaktus eingefaßt; immer dichter blüht es und rankt es sich um die stacheligen Hecken mit ihren schwefelgelben Blüten, weite Kornfelder wogen, Olivenhaine wechseln mit Feigen- und Orangenpflanzungen, wie ein dunkler Wald dehnen sich die Fruchtbäume über breite Flächen aus, und hie und da schwankt im blendenden Sonnenglanz eine schlanke Palme. Halbnackte braune Menschen liegen im Schatten und winken dem vorbeisausenden Zuge nach, die hölzernen Schöpfräder knarren in den Feldern, wir kommen an Solarussa vorüber, wo der feurigste Wein Sardiniens, der weiße blumenreiche Vernaccia wächst, überschreiten den Tirso, der durch breite Sandbänke seinen sommerlichen Lauf nimmt, und fahren in Oristano ein.
LA TREBBIA DEL GRANO
Il grano viene sgusciato dalla testa dagli zoccoli ferrati dei buoi che passano più volte sulla paglia. Successivamente la paglia e la pula vengono lanciate in aria con le forche e il vento vaglia il grano.
ORISTANO
Weitläufig zieht sich die Stadt mit ihren niedrigen weißen Lehmhäusern und sandigen Straßen zwischen dunkelgrünen Orangengärten hin, überragt von Türmen, Kuppeln und Palmen, als wären wir plößlich ins Morgenland verseht. Und damit auch der Hauch der höheren Kultur nicht fehle, streiten sich am Ausgang des Bahnhofs ein paar Jungen mit nackten Beinen um die Ehre, meinen Ranzen tragen zu dürfen, einige höchst fragwürdige Fahrzeuge werden mir als buone carrozze angepriesen, und die Zollwächter mit dem grünen Kragen fragen mich, ob ich keine Eßwaren einschmuggele. Ich habe nur Lust aufzuessen, was zu finden ist, und lasse mich nach dem Albergo geleiten.
Unter den Palmen von Oristano weilte ich mehrere Tage, allerdings nicht ungestraft. Das Gasthaus, in dem ich eingekehrt war, gehörte zu den empfohlenen, aber es teilte das Geschick der meisten italienischen Häuser mittleren Ranges, es wurde selten oder nie gereinigt und war infolge dessen reich bevölkert von allem, was da kreucht und fleucht. Dagegen waren die Wirtsleute die Herzlichkeit selbst und die Verpflegung war sehr gut, wenn auch die Speisekarte nicht allzu lang war. Das Ochsenfleisch ist überhaupt in Sardinien bedeutend besser als in Rom; man bekommt schöne unverfälschte Fleischbrühsuppen, die nicht aus heißem Wasser und Speck gemacht sind, sowie saftigen fetten lesso (Suppenfleisch); auch die Hühner und gebratenen Rippenstücke von Lammund Ziegenfleisch sind nicht übel. Der Salat ist über jeden Tadel erhaben, er wird in schmale lange Streifchen geschnitten, und das condimento von Essig und Del ist ausgezeichnet. An großen frischen Eiern ist kein Mangel; Kirschen, Orangen und Nespole (Mispeln) sind in Hülle und Fülle zu haben; das Brot ist kräftiger als in Rom und gut ausgebacken.
Dazu trinkt man einen reinen Wein, der wohlschmeckender und feuriger ist als die Weine des Festlands, das halbe Liter zu 10 Centesimi, und den man tüchtig mit Wasser oder dem aus den Bergen geholten natürlichen Eis verdünnen kann. Meine sardischen Tischgenossen verbrauchten beim Essen eine Unmenge Wasser, die Größe der Gläser war schon darauf eingerichtet; sie spülten sich während der Tafel wiederholt den Mund aus und spieen dann den ganzen Strahl ins Zimmer. Das kühlt die Luft etwas ab. Die Bedienung bei Tische wurde von der hübschen Wirtstochter besorgt, die barfuß und bloßarmig mitfliegendem Kopftuch wie ein Wiesel hin und her lief. Ueberhaupt zeichnen sich die Frauen der Insel durch Flinkheit und Geschmeidigkeit aus; es ist ein schönes Bild, wenn sie troß der sengenden Hike munter über die Straße eilen, den großen runden Wasserkrug auf dem Kopfe, dem ein langes flatterndes Tuch von brauner oder roter Farbe, das bis zu den Hüften herabhängt, Kühlung zuweht. Die Männer sind in ihren Bewegungen gemessener und würdevoller, aber im Verkehr mit Fremden höflich und entgegenkommend.
Ich habe die Leute bei verschiedenen Gelegenheiten in ihrem Leben und Treiben beobachtet und mich gern mit ihnen unterhalten; sie wurden nie lästig oder aufdringlich, sondern behandelten den Fremden stets mit freundschaftlicher Achtung.
So habe ich mitten unter dem Volk von Oristano am Pfingstsonntag das Verfassungsfest gefeiert, welches in ganz Italien geseklich am ersten Sonntag des Juni begangen wird. Von der festlichen Beleuchtung und der Musik am Abend ist ja nichts besonderes zu sagen, das ist in ganz Italien gleich, wenn auch nicht überall gerade 30000 Lire wie bei der römischen Girandola unnük verpufft werden. Eigenartig aber war die Volksbelustigung am Nachmittag auf einer kleinen Hochfläche dicht vor der Stadt, wo ein Kloster mit seinen Nebenbauten und die neue Wasserleitungsanlage einen von Bäumen beschatteten Plak umschließen. Dort lehnte sich an ein paar Kneipen in malerischen Feigen- und Orangengärten eine kleine Zeltstadt. Lustige Hütten mit geflochtenem Schilfdach gaben kühlen Schatten, darunter saß und lag alles bunt durcheinander, Wein und Limonade trinkend und dazu allerhand getrocknete Körnerkauend, die von wandernden Händlern feilgeboten wurden.
In mancherlei Marktbuden wurden neben buntem Spielkram bemerkenswerte Erzeugnisse des heimischen Hausgewerbes verkauft, wie irdene Gefäße von ganz antiken Formen, flache runde Körbe von feinstem gelben Binsengeflecht, hölzerner, roh geschnikter Hausrat und Werkzeuge für die Feldarbeit, das meiste von überraschendster Einfachheit, wie z. B. die aus einem einzigen Stück mit Benukung der natürlichen Astteilung geschnittene Heugabel.
Um den fremden Gast, der dies alles musterte, hatte sich rasch ein Kreis von „Honoratioren“ gesammelt, ein paar liebenswürdige Zivilisten, ein Zollbrigadier u. s. w., die es sich angelegen sein ließen, mich über dies und jenes aufzuklären und mich aufs beste zu unterhalten. Wir nahmen schließlich auf einer Wiese im Schatten von Feigen- und Mispelbäumen Plak; sie ließen sich von Rom und dann von Deutschland erzählen, brachten Wilhelm II. und dem Dreibund ein Hoch und duldeten nicht, daß ich auch nur einen Soldo zahlte.
Inzwischen war ein Musikant herangekommen; er trug das unverfälschte sardische Kostüm, um die Stirn und den Rand der schwarzen Sackmüze war ein rotes Tuch lose gewunden, über den Rücken hing ihm das dicke braune Ziegenfell. Sein Instrument war die nationale dreifache Rohrflöte, wie sie oft auf antiken Wandgemälden und Vasenbildern dargestellt ist; sie besteht aus drei einzelnen Schilfrohren von ungleicher Dicke und Länge, die gleichzeitig in den Mund gesteckt und mit wenigen einfachen Fingergriffen geblasen werden. Je nachdem seine Melodie es verlangt, die er im Kopf und Herzen, aber nicht auf dem Papier stehen hat, nimmt der Flötenbläser ab und zu ein Rohr aus dem Munde und bläst auf zweien oder einem weiter. Im Spielen wiegt er leise den zottigen Kopf und schließt die Augen, seine Weise ist schwermütig und weich; wie er da mit seinem Ziegenfell unter dem Feigenbaum sikt, gleicht er einem Satyr, der einer Nymphe sein Liebessehnen vorflötet.
UN GRUPPO DI CONTADINI IN ACCAMPAMENTO DURANTE LA FESTA DI SANTA GRECA
Molte famiglie del Campidano, a nord di Cagliari, arrivano con utensili da cucina e strumenti musicali e si accampano per tutta la durata della festa.
Bauern, die im trockenen Flussbett eines Sturzbaches in Decimomannu (nahe Cagliari) während des Festes der Heiligen Greca lagern.
BEIM JÄHRLICHEN FEST DER HEILIGEN GRECA
Die Bauernfamilien kommen mit ihren Wagen nach Decimomannu und bleiben zwei bis drei Tage. Sie schlagen ihr Lager in der Nähe des Dorfes auf und braten Schweine und Widder über den Lagerfeuern. Ein Akkordeon oder ein anderes Musikinstrument ist ebenso unverzichtbar wie die Küchenutensilien.
CABRAS
Der Weg nach diesem, etwa zwei Stunden von Oristano entfernt an einem Strandsee liegenden Fischerdorf führt auf breiter staubiger Fahrstraße zwischen Kaktushecken und uralten Silberpappeln zunächst bis zum Flusse Tirso, den eine stattliche Brücke mit fünf Bogen überspannt. Im Sommer begreift man freilich kaum, wozu die lange Brücke, denn mehr als die Hälfte des Flußbettes ist jekt von leichtem welligen Sand angefüllt, und das Wasser steht im übrigen Teile so niedrig, daß die Weiber, die dort ihre Wäsche besorgen, mit den nackten Beinen bis in die Mitte vordringen.
Sie haben eine besondere Geschicklichkeit, ihren bunten Rock so anzuordnen, daß sie bis über die Kniee im Wasser stehen können, indem sie ihn in der Mitte aufraffen, zwischen den Beinen durchziehen und am Gürtel so befestigen, daß das Ganze der Pluderhose eines Landsknechts gleicht. In Bezug auf Zungenfertigkeit geben sie übrigens ihren Genossinnen in Deutschland nichts nach; das dicht umgrünte Thal des Tirso hallte wider von ihrem unermüdlichen Kreischen.
Es war überhaupt sehr laut und lebendig da draußen, als ich am frühen Morgen durch die weite Ebene nach Cabras wanderte. Denn zum Markt in Oristano ziehend, kamen mir Scharen von Landleuten und Fischern aus den Nachbarorten Donigala, Massama, Solanas, Cabras und weiterher entgegen. Zu Fuß, zu Pferd und in Wagen, Rindvieh, Fohlen und Schweine zum Verkauf mitführend, zogen sie vorbei, und fast keiner versäumte den freundlichen Zuruf: Bona dies! oder saluto! Es war ein unaufhörliches Grüßen und Erwidern, dem ich eine halbe Stunde lang standhalten mußte.
Als ich bei Donigala von der Hauptstraße abgebogen war, wurde es wieder stiller; nur die Pinien rauschten im Wind und ihre Aeste knarrten.
ZUM JÄHRLICHEN FEST DER HEILIGEN GRECA
Die Bauernfamilien reisen mit ihren Wagen nach Decimomannu und bleiben zwei bis drei Tage. Sie schlagen ihr Lager in der Nähe des Dorfes auf und braten Schweine und Widder über den offenen Feuern. Ein Akkordeon oder ein anderes Musikinstrument ist dabei ebenso unverzichtbar wie die Küchenutensilien.
Es ge hört nämlich zu den Witterungseigentümlichkeiten jener Küstenebene, daß bei wolkenlosem Himmel und glühender Sonne ununterbrochen ein sturmartiger Wind vom Meere her weht. Dicht an dem flachen Strand weht der Wind so stark, daß man sich mühsam aufrecht hält, und die braunviolette salzige Flut beständig weit über den körnigen Küstensand hinaufrollt. Mit tiefem weichen Sand sind auch die breiten stillen Straßen von Cabras bedeckt, was den afrikanischen Charakter des Ortes noch erhöht. In langen Reihen liegen die einstöckigen weißgekalkten Häuser mit wenigen Fenstern, ihre Wände werfen das Licht blendend zurück, und über den Hofmauern hängt da und dort ein Feigenbaum oder ragt eine Palme mit wehenden gefiederten Zweigen. Auf niedriger Felshöhe hart am Meer steht eine Kirche mit schreiend bunten Mauern und einer von farbigen Ziegeln bedeckten Kuppel, daneben liegen die spärlichen Trümmer einer Burg, wo einst die Fürstin Eleonora von Arborea herrschte und dem. Lande ein freiheitliches Gesezbuch verlieh. Ein Marmorstandbild in Oristano erinnert noch an die weise Herrscherin des 15. Jahrhunderts, und in zahlreichen Benennungen von Straßen, Gebäuden u. s. w. in der ganzen Gegend ist ihr Name erhalten.
Die Straßen von Cabras waren wie ausgestorben, als ich nach einer Schenke suchend hindurchging; das Leben beschränkt sich auf das Innere der Häuser und die dahinterliegenden Höfe und Gärtchen, wo man vor Sonne und Wind geschützt ist. An einer flatternden verblaßten Fahne über der Thür erkannte ich eine kleine Weinschenke und trat ein. Der Raum erhält sein Licht nur durch die halbgeschlossene Thüre von der Straße und durch eine andere Thür von dem mit Feigen und blühenden Granaten bepflanzten Hofe her; es herrscht eine kühle Dämmerung. Auf dem festgestampften Fußboden sizen auf niederen plumpen Schemeln an den Wänden entlang die Gäste, Tische gibt es nicht; jeder hat vor sich auf dem Boden einen irdenen glasierten Topf mit Wein stehen und bedient sich zum Trinken eines Glases oder des in der Tasche mitgeführten kleinen Bechers, der aus einem hohlen Stück Rindshorn mit Korkboden besteht.
Die Wirtin sikt vor dem Fasse mit gekreuzten Beinen auf einer Schilfmatte, auf der das übrige Geschirr herumsteht. Zu essen gibt es nichts; wer Hunger hat, kann schräg gegenüber bei einer alten Frau, die ein Kramlädchen hält, Brot, Eier und rohe lattuga (Salat) haben. Die Gesellschaft besteht fast ausschließlich aus Fischern, prächtigen wetterharten Gestalten mit nackten braunen Beinen. Sie tragen alle das Nationalkostüm, weite weißleinene, bis zum Knie reichende Hosen, den Schurz und die Jacke sowie die biridda (Sackmüße) aus grobem schwarzem Wollenstoff; zum besseren Schuß gegen die Sonne schlingen sie ein grellbuntes Tuch um die Stirn. Die ganze Versammlung macht einen ernsten, fast feierlichen Eindruck, gesprochen wird nicht viel, man lauscht stumm den melancholischen Tönen der Rohrflöte.
Der Eintritt des Fremdlings ist ein Ereignis, das Bewegung in die Gesellschaft bringt; die glänzenden dunkeln Augen richten sich neugierig auf ihn, und eine freudige Genugthuung drückt sich auf den wilden, sonnverbrannten Gesichtern aus, als seine Absicht kund wird, den einen oder anderen ins Skizzenbuch zu zeichnen. Ich habe hierfür unter den Männern stets die größte Bereitwilligkeit gefunden und zahlreiche fremdartige Gestalten mit nach Hause bringen können; nur mußte ich nach jeder Aufnahme das Buch die Runde machen lassen und erhielt es dann mit Ausdrücken der Bewunderung und mit den Abdrücken aller anwesenden Finger wieder zurück.
Die meisten wollten auch ihren Namen beigefügt haben, und ein stolzer Vater, der mich bat, seinen Jungen zu zeichnen, erzählte mir dazu dessen ganze Lebensgeschichte. Einige Mühe kostete es jedoch, die Tochter der Wirtin, ein blühendes Weib mit lachenden Augen, meiner Sammlung einzuverleiben. Erst das Zureden sämtlicher anwesenden alten Fischer bewirkte, daß sie auf der Schilfmatte vor dem Fasse, wo sie ihre Mutter ablöste, einige Minuten still hielt.
In diesem Augenblick hätte ich statt eines Dilettanten ein Künstler sein mögen, um diese Gestalt voll natürlicher Anmut, Ebenmaß und Fülle würdig festzuhalten, die in ihrer schmucken Tracht etwas geradezu Berückendes hatte. Unter dem hellbraunen Rock schauten die wohlgeformten, durch keinen modernen Schuh verkümmerten Füße heraus, den schlanken Leib umschloß ein niedriges rund ausgeschnittenes Mieder aus rot- und goldgemustertem Seidenstoff, aus dem in weiten Falten das blütenweiße Hemd hervorquoll, dessen Aermel den runden Arm nur bis knapp über den Ellbogen bedeckten. Ein gelbseidenes Tuch lag um den bloßen Hals und war über den vollen Busen herunter ins Mieder gesteckt; ein ähnliches Tuch mit bunten Streifen lag lose über dem Kopf, dessen blauschwarzes Haar nach Art der griechischen Frisur von einem feuerroten.
Tuch glatt anliegend umwunden war. Zierlich gearbeitete silberne Kugelknöpfchen mit einem Kettchen hielten am Hals das weitausgeschnittene Hemd zusammen. Als ich das alles gezeichnet und flüchtig in Farben angelegt hatte, da war die Schöne von Cabras schließlich selbst ganz zufrieden; sie war ja auch nur eine Evastochter und der Eitelkeit nicht abhold.
Ich nahm herzlichen Abschied von dem urwüchsigen Volk in der Schenke, warf vom windigen Strand noch einen Blick hinüber, wo jenseits der Salzflut auf steilem Vorgebirge die Trümmer der alten Phönizierstadt Tharros ragen, und trat zwischen blütenumwobenen Kaktushecken den Rückweg an.
DONIGALA
In Donigala fesselte mich noch ein freundliches Malerabenteuer. Ich war in ein Haus getreten, wo die ganze Familie in origineller Gruppe um die Feuerstätte saß, und hatte die Erlaubnis erhalten, die ganze Gesellschaft zu porträtieren. Während ich emsig zeichnete und pinselte, bewirtete man mich mit Wein, und der Hausherr blätterte aufmerksam in meinem Skizzenbuch. Als die Aquarellskizze nach einem Stündchen fertig und von allen Anwesenden lachend bewundert war, wollte ich mich dankend verabschieden; der barfüßige Hausherr aber suchte in seiner weiten Hose und reichte mir einen sardischen Soldo (10 Centesimi). Ich bekam einen kleinen Schrecken und glaubte, der Alte wolle mir die Skizze abkaufen. Weit gefehlt! Der gute Bauer erfüllte nur alte sardische Pflicht und gab seinem Gast das Viaticum mit auf die Wanderung. So kam ich als malender Handwerksbursch um 10 Centesimi reicher nach Oristano zurück.
… und noch einmal ORISTANO
In Oristano ist manch altes Gebäude aus besseren Zeiten, allerhand Stilarten sind vertreten, Renaissance, Gotik und auch jenes normanisch- sarazenische Stilgemisch, an dem besonders Sicilien reich ist; so finden sich viele malerische Ecken und Winkel in dem Ort, zumal der südliche Pflanzenwuchs mit seinem satten Grün und der grellen Blütenpracht belebend dazwischentritt. Einen merkwürdigen Ort habe ich dort noch kennen gelernt, wohin wohl selten ein Fremder kommt, und davon sei zum Schluß erzählt, weil der Sardinienreisende sich eine Lehre daraus ziehen kann. Ich habe eine Nacht in der camera di sicurezza, dem Polizeigewahrsam zugebracht. Grund: der Revolver in meiner Tasche ohne zugehörigen Erlaubnisschein. Ich hatte die Waffe unvorsichtigerweise sehen lassen, und die braven Carabinieri von Oristano wollten um jeden Preis ihre Pflicht thun. Wäre ich wie in Rom mit Gehrock und Cylinderhut einhergegangen, so hätten die Wächter des Gesezes aus Achtung vor meinem Rock vielleicht ein Einsehen gehabt; da aber mein Reisekostüm mehr praktisch als vornehm war und mein Gesicht sehr gebräunt und unrasier2t, so kann ich selbst es den Carabinieri kaum verdenken, daß sie mich für etwas Gefährliches hielten, mich nach frommer Häschersitte still in ihre Mitte nahmen und die Thür der camera di sicurezza hinter mir abschlossen.
Drinnen lag auf der Pritsche bereits ein anderer Brigant, dem man die Füße in den Block geschlossen hatte. Da er aber die Hände frei hatte, so zog ich vor, mich nicht neben ihn zu legen, sondern in der Fensternische das Eisengitter umarmend, das mich von der goldenen Freiheit trennte, die Nacht zuzubringen. Am Morgen wurde ich mit erfreulicher Raschheit vor den Prätor geführt; der erklärte mir, die ganze Insel Sardinien fühle sich durch meinen Besuch hoch geehrt, aber das Gesez sei für alle gleich, und dann verurteilte er mich nach Artikel 464 des Strafgesekbuchs wegen unerlaubten Waffentragens zu vier Tagen Haft. Seinen Rat, die Gnade des Königs anzurufen, habe ich natürlich befolgt und nicht umsonst. Als ich aber, vorläufig auf freien Fuß gesekt, ein paar Tage später am Capo Figari den Dampfer nach Civitavecchia zusammen mit einer Rinderherde bestieg, die durch das Deckoberlicht ihre Schwänze in den Speisesaal herabhängen ließ, und der seltsamen Insel lebewohl zuwinkte, da schwur ich mir, wenn ich je wiederkehrte, weder Büchse noch Schießpulver, wohl aber eine Büchse voll Insektenpulver mitzunehmen; denn das ist nicht strafbar und dient jedenfalls dazu, den Genuß der Schönheiten Sardiniens von mancher Trübung zu befreien.
ZWEITE REISE, APRIL 1898
* STREIFZÜGE DURCH SARDINIEN (1898)
* VON GOLFO ARANCI NACH OLBIA
Nachdem ich vor sechs Jahren die Pfingstwoche in Sardinien zugebracht hatte, war die seltsame Insel für mich ein Magnet von mächtiger Anziehungskraft geworden, gleich einer flüchtigen interessanten Bekanntschaft, der man gar zu gern etwas näher treten möchte, und die durch ihre Sprödigkeit das Verlangen nur steigert.
So nahm ich mit Freuden die Gelegenheit wahr, als zwei römische Freunde eine gemeinsame Fahrt nach Tunis planten, und schloß mich ihnen mit der Bedingung an, daß der Weg über Sardinien genommen werde. Auch für Vielgereiste ist die Insel immer noch eine merkwürdige Unbekannte, die erst entdeckt werden will.
Mit einem der ältesten gichtbrüchigsten Dampfer der Navigazione Generale von Civitavecchia ankommend, stiegen wir in der Morgendämmerung im Golfo degli Aranci ans Land. In dem einsamen dürftigen Bahnhof, an dem der Dampfer anlegt, warteten außer uns nur noch drei auf Urlaub gehende Soldaten und ein Handlungsreisender auf die Abfahrt des die ganze Insel bis Cagliari durchfahrenden Zuges.
Der Verkehr ist auch auf dieser Hauptlinie Sardiniens sehr gering, und der ganze Betrieb der Bahn nimmt davon seinen besonderen Charakter an. Volle zwölf Stunden liegt der Reisende auf der nur 397 Kilometer langen Strecke, und der kleine Zug führt nur einen einzigen Wagen erster und zweiter Klasse; Erträge wirft der Bahnbetrieb nicht ab, er wird nur durch einen nach der Kilometerzahl berechneten Staatszuschuß aufrecht erhalten, worauf sich die Behauptung gründet, daß die Eisenbahngesellschaft willkürlich die Strecke durch zahlreiche Kreuz- und Querwindungen verlängert habe, um ihren Kilometerzuschuß in die Höhe zu treiben.
Dafür liefert sogleich der erste Teil der Fahrt einen ergözlichen Beleg, denn um vom Golfo degli Aranci nach dem am Ende derselben Bucht gelegenen, in gerader Linie 12 Kilometer entfernten Ort Terranuova [Olbia] zu gelangen, muß man 23 Bahnkilometer zurücklegen, ohne dabei eine größere Meereshöhe zu erreichen, und man gebraucht dazu eine volle Stunde.
Landschaftlich ist diese künstlich geschlängelte Strecke sehr schön; man fährt zwischen Buchten und Vorgebirgen hin und her, bald hat man das Meer links, bald rechts; dann dringt man in eine öde Berggegend ein, wo niedriges immergrünes Gestrüpp mit grauem Felsgeröll und Weideflächen wechselt, und wenn man glaubt, im Binnenland zu sein, da taucht auf einmal das Meer wieder auf, der enge innerste Zipfel des Orangengolfs, an dem man aber vergebens nach Orangen sucht.
Dafür bot uns der kurze Halt auf der Station Terranuova einen anderen Genuß, denn die Sonne ging gerade hinter den zerklüfteten Vorgebirgen auf und beleuchtete im feuchten Morgendunst märchenhaft die stille Wasserfläche des Golfes.
Es war ein wetterwendischer Tag. Der graue Wolkenschleier, durch den nur selten die Sonne oder ein Stück blauen Himmels leuchtete, erhöhte den melancholischen Eindruck der sardischen Landschaft.
Auf meilenlanger Fahrt durch die von Frühlingsregen bewässerten Thäler zwischen Weideabhängen und rauhen Bergzügen war kein bewohnter Ort zu sehen, hier und da nur ein Wärterhaus oder ein einsamer stazzo, kleine Herden von Rindvieh und Pferden, und von Menschen nur ab und zu ein wild aussehender Hirt, in Felle gehüllt und die dunkele Kapuze zum Schuß gegen den Regen über den schwarzbärtigen Kopf gezogen, oder ein einzelner Reiter mit der Büchse über dem Rücken, woraus die Phantasie des Reisenden leicht einen Briganten machen konnte. Ohne Mühe hätte man die Menschen zählen können, denen unser Zug während einiger Stunden begegnete.
VON MONTI NACH MACOMER
Gespräch mit zwei Damen über Bräuche, soziale Verhältnisse, Banditen und Nuraghen
Auf der Haltestelle Monti, wo die Zweigbahn von Tempio her mündet, fiel ein Sonnenstrahl in unsere Fahrt: eine junge Sardin stieg mit drei Kinderchen ein, begleitet von einer hübschen Magd, der das schwarze bis auf die Hüften niederfallende mantelartige Kopftuch mit der breiten Borte von hellblauer Seide gar gut stand. Auch die junge Mutter war anmutig und frisch: man sah ihr nicht an, daß sie in fünfjähriger Che schon vier Kindern das Leben gegeben hatte, obwohl sie erst einundzwanzig Jahre zählte.
Ihr Vater, ein biederer Bauer, besorgte sie mit ihrer kleinen Schar in das einzige Abteil zweiter Klasse, denn sie war an einen Bergingenieur verheiratet, während er ganz bescheiden in der dritten Plaz nahm. Die drei Kinderchen benahmen sich zwar nicht ganz so, wie man es in der zweiten Klasse erwarten sollte, und machten ihre hübsche Mutter einigemal kräftig erröten; dagegen bot uns die Unterhaltung mit ihr ein ungewöhnliches Vergnügen, denn sie sprach ohne jegliche Scheu mit uns über Haus und Heimat und zeigte sich als ein Muster urwüchsiger sardischer Naivetät. Hatte zuvor auf der Seefahrt ein Festlandsitaliener uns einen Abscheu vor der rohen Unsittlichkeit der Inselbevölkerung beizubringen versucht, die meist den Abschluß der Che von dem zuvor verbürgten Erfolg der Stammeserhaltung abhängig mache, so korrigierte die junge Frau diese schiefe Vorstellung in wirksamster Weise.
Von ihr erfuhren wir, daß bei aller Verschiedenheit sardischer Sitten von den festländischen doch eine große Strenge den Verkehr der Geschlechter beherrscht, und daß ein junger Mann mit seiner zukünftigen Gefährtin das erste Wort meist erst dann wechselt, nachdem er bei den Eltern in aller Form um sie angehalten hat; das Liebeswerben bei ihr selber beschränkt sich gewöhnlich auf den Austausch von Blicken und Winken bis zu dem Augenblick, wo das Jawort ihrer Eltern dem Bräutigam den Eintritt in ihr Haus gestattet.
Von dem Maßstab sardischer Reinlichkeit erhielten wir auch aus den Erzählungen der jungen Mutter einen Begriff, indem sie mit großer Wichtigkeit von den mühsamen Vorbereitungen zu ihrer Reise sprach, die im wesentlichen darin bestanden, ihren drei Kinderchen die Gesichter zu waschen.
Um sardische Zustände und Bräuche drehte sich auch weiterhin die Unterhaltung fast ausschließlich, nachdem eine Dame der besseren Stände aus Oristano eingestiegen war, die sich freute, einige Fremde über die Angelegenheiten ihrer Heimat unterrichten zu können. Fremde waren nicht wir Deutsche allein, sondern auch ein italienischer Leutnant vom Festland, dessen Vorstellungen von Sardinien nicht vollkommener waren als die unseren.
Die Oristanerin, die ihrer Landsmännin aus Tempio an gesunder Schönheit nichts nachgab, geriet in eine edle Entrüstung, die ihr recht gut ließ, als die Rede auf den mangelhaften Zustand der öffenlichen Sicherheit Sardiniens kam. „Wir Sarden,“ sagte sie, „sind draußen nicht nur unbekannt, sondern auch abbandonnati und calunniati, verlassen und verleumdet; hier gibt es nicht mehr Uebelthäter als anderswo, und der Fremde wird nirgends in der Welt mit gleicher Chrerbietung und freundlicher Rücksicht aufgenommen wie bei uns. „
Wir könnten, fuhr sie fort, durch die wildesten Gegenden Sardiniens reisen, ohne daß uns ein Haar gekrümmt würde; nur dürften wir, wenn wir Millionen bei uns führten, das nicht vorher ausposaunen, sonst würden sie uns wohl gelegentlich abgenommen, gerade so gut wie anderwärts. Herzliche Gastlichkeit aber fänden wir auf der ganzen Insel, selbst bei den Banditen, die mit dem Gesek im Streit leben und den Anlaß zu den Gerüchten von der Unsicherheit Sardiniens geben.
In eine wahre Begeisterung redete sie sich nun hinein, gerade als ob sie selbst nahe Angehörige unter den Banditen hätte, als sie uns klar zu machen versuchte, daß die Sarden nicht gemeiner Verbrechen wegen, sondern infolge leidenschaftlicher Familienkämpfe, privater Rachethaten u. dergl. aus angeborenem Hang zur Freiheit sich in die macchia (in den Busch) schlagen, um mit ihrer Büchse ein ungebundenes Leben zu führen, statt einige Jahre hinter Schloß und Riegel zu vertrauern.
„Wir sind ungebildet,“ schloß sie mit einem Seufzer, „und das ist unser Unglück; die große Masse unseres Volkes lernt nicht beizeiten, was man thun und lassen darf, aber im Grunde ist unser Volk gut, ritterlich und gastfrei.“
Unter solchen Gesprächen, die im großen Ganzen mit meinen eigenen Beobachtungen über sardisches Volkstum übereinstimmten, gelangten wir in das Hochland bei Macomer, wo die Gegend der Nuraghen beginnt.
Mit der Gelehrtenhypothese, daß diese steinernen Türme für Befestigungs- und Verteidigungszwecke dienten, war aber der Leutnant gar nicht einverstanden. Auf verschiedenen Dienstreisen in Sardinien hatte er sich eine andere Ansicht gebildet, die er uns in einleuchtender Weise vortrug. Wenn die Nuraghen kriegerischen Zwecken dienen sollten, so meinte er, dann würden sie sich durchweg in beherrschenden Stellungen finden und müßten einen größeren Umfang haben, um einer größeren Zahl Zuflucht und Stükpunkt bieten zu können. Aber beides ist nicht der Fall; viele Nuraghen liegen in ganz flachem Gelände oder im Thal, und selbst die größten können höchstens zur Not zwanzig Menschen beherbergen; auch sind in den Nuraghen keinerlei Funde an Altertümern gemacht worden, die auf eine kriegerische Bestimmung hinweisen. Dagegen ist es fast allen Nuraghen heute noch gemeinsam, daß sie im Weideland liegen, wohin zu gewissen Jahreszeiten die nomadisierenden Hirten mit ihren Herden zusammenkommen; noch heute sucht der sardische Hirt Obdach unter den Trümmern des Nuraghs, man braucht nur den Blick links und rechts von der Bahnstrecke schweifen zu lassen, um sich davon zu überzeugen. In den fruchtbaren Tiefebenen dagegen, wo Korn und Wein gedeiht und keine Viehweiden in großem Maßstab liegen, gibt es überhaupt keine Nuraghen. Ergo, die Nuraghen sind nichts anderes als Sammelpunkt und Obdach für die nomadisierende Hirtenbevölkerung gewesen. Diese Erklärung klang mir um so überzeugender, als noch heute auf den Hochflächen, die zur Viehweide dienen, kegelförmige Türme zu gleichem Zweck aus rohem Mauerwerk aufgeführt werden, die nur weniger solid gebaut sind als die seit Jahrtausenden stehenden Nuraghen. Die Verwendung des dauerhaften Steinmaterials an Stelle von Holz und Reisig erklärt sich heute wie in alter Zeit zum Teil aus dem Ueberfluß des ersteren im Vergleich zu lekterem, teils aus der größeren Gewähr für langen Bestand, die der Steinbau bietet, ein Umstand, auf welchen Herdenbesizer, die regelmäßig bestimmte Gebiete beweideten, gewiß auch Wert legten.
In Macomer, dem lebhaftesten Knotenpunkt der sardischen Bahnen, von dem nach vier Richtungen Linien auslaufen, kamen wir gegen Mittag an. Der Grundsak der sardischen Bahnen „Eile mit Weile“ findet dort eine hübsche Illustration. Hundert Meter vor dem Stationsgebäude steht das Hotel- Restaurant, wo die Reisenden zu Mittag zu essen pflegen. Daher hält der Zug zuerst hier an, indem der Schaffner ausruft: Macomer Ristorante! Wenn alle Hungrigen ausgestiegen sind, fährt der Zug nach Macomer Stazione und bleibt dort eine gute halbe Stunde liegen. „Geben Sie acht,“ sagte unser Leutnant, „wir fahren nicht eher weiter, als bis alle Fahrgäste sich satt gegessen haben; es ist schon vorgekommen, daß der Zug zehn Minuten länger gewartet hat, weil ein bestelltes Beefsteak nicht rechtzeitig fertig geworden war. „Und ähnlich ging es auch diesmal. Wir saßen nach vollendetem Mahl bereits wieder auf unseren Pläken, als der Zugführer herankam und sich ausdrücklich erkundigte, ob die drei forestieri wieder eingestiegen wären, erst dann gab er das Zeichen zur Abfahrt.
Man treibt es eben gemütlich auf den sardischen Linien, die Fahrpläne sind mit großer Bequemlichkeit aufgestellt, und der Sarde kennt es kaum anders, als daß er morgens abreist und abends ankommt. Mehr verlangt er nicht, aber Verspätungen lernt er auch selten kennen, wohl aber Verfrühungen, eine entseßliche Neubildung von Wort, die nirgends in der Welt eine Daseinsberechtigung hat außer in Sardinien. Wir kamen in der That auf den meisten Stationen einige Minuten vor der fahrplanmäßigen Zeit an.
Von den Höhen bei Macomer übersahen wir durch die vom Regen gereinigte klare Luft schon den ganzen Campidano von Oristano bis zu den Strandseen und dem Meere, bis zum Vorgebirge S. Marco mit den Ruinen von Tharros nördlich und zu dem zackigen Bergkamm des Monte Arcuentu südlich des Golfs von Oristano.
CAGLIARI
Einmal in dem Campidano mit seinem afrikanischen Charakter angekommen, verläßt die Bahn die Ebene nicht mehr. Weites fruchtbares Gefild dehnt sich zu beiden Seiten der Linie bis an den Fuß der Gebirge; von Kaktushecken und Palmen umgeben liegen lang hingestreckt die Dörfer in der Ebene, ein niederer gelber Mauerstreifen, den nur der Glockenturm und die Kuppel der Kirche überragen.
So dehnt sich in üppiger Einförmigkeit die Thalebene des Simassi bis nach Cagliari aus. Der Glanz der flachen Lagunen kündigt die Nähe des Meeres an, und über dem grünen Gefild erhebt sich auf breitem Strandfelsen die helle Häusermasse von Cagliari, dahinter der scharfgeschwungene Umriß des Vorgebirges S. Elia.
In Cagliari hat man endlich nach der Tagesfahrt durch eine fremdartige Welt und oft verödete Landschaft wieder das Gefühl, im gewohnten Alltagsgetriebe zu sein. An dem von Schiffen belebten geräumigen Hafen ziehen breite Straßen mit modernen Häusern hin, zwei Bahnhöfe mit glasgedeckten Einfahrtshallen bilden die Endpunkte dieses Verkehrszentrums.
Man vermißt allerdings als notwendige Ergänzung der modernen Vollkommenheiten den Gasthofsomnibus; statt dessen geleitet uns der Oberkellner zu Fuß nach dem auf steiler Höhe gelegenen, eine prächtige Umschau bietenden Gasthof Scala di Ferro, und ein Eselswägelchen bringt unser Gepäck nach.
Von dem Fenster des Zimmers, in welchem ich diesen Reisebericht schreibe, schweift mein Blick über Stadt und Hafen am Eliasvorgebirge vorbei über die blauen Fluten des Meeres, hinter welchem in unsichtbarer Weite die afrikanische Küste mit der Stätte des alten Karthago liegt. Als ich mich aber mit Freimarken für meine Korrespondenz versehen wollte, mußte ich vergebens durch drei Tabakläden laufen, um eine 25-Centesimimarke zu suchen, und der Verkäufer fragte, als ich den Mangel zu rügen wagte, mit Verwunderung zurück: „Ma chi scrive da qui all‘ estero?“ (Wer schreibt auch von hier ins Ausland?)
Das eingesessene Volk hier weiß wenig oder nichts vom Ausland und lebt für sich abgeschlossen auf seiner meerumwogten Insel, als ob sie nicht für die Welt und die Welt nicht für sie existierte. Das war in alten Zeiten anders, als Römer und Punier um den Besik dieser ehemaligen Kornkammer stritten.
Der Sehenswürdigkeiten von Cagliari, soweit sie pflichtmäßig an der Hand des Reisehandbuchs genossen werden müssen, sind nicht viele; man kann in wenigen Stunden damit fertig sein. Zu dem Besten gehört ein Besuch der in einen Spaziergang verwandelten Bastion S. Caterina, die vom Kastell aus nach Süden hin vorspringt und einen ausgezeichneten Ueberblick über die Stadt, den Golf und die umliegenden Teile der Insel gewährt.
Mich zog von allem, was wir da überschauten, am meisten ein Dorf an, das man lang hingestreckt hinter einem der Strandseen nach Nordosten liegen sieht, Quarto S. Elena.
* PALMSONNTAG IN QUARTO S. ELENA
Der Sehenswürdigkeiten von Cagliari, soweit sie pflichtmäßig an der Hand des Reisehandbuchs genossen werden müssen, sind nicht viele; man kann in wenigen Stunden damit fertig sein.
Zu dem Besten gehört ein Besuch der in einen Spaziergang verwandelten Bastion S. Caterina, die vom Kastell aus nach Süden hin vorspringt und einen ausgezeichneten Ueberblick über die Stadt, den Golf und die umliegenden Teile der Insel gewährt. Mich zog von allem, was wir da überschauten, am meisten ein Dorf an, das man lang hingestreckt hinter einem der Strandseen nach Nordosten liegen sieht, Quarto S. Elena.
Es zeichnet sich äußerlich durch nichts vor den anderen Orten des Campidano von Cagliari aus, aber Bädeker rühmt die Trachten seiner Bewohner und gewisse festliche Bräuche wie den Spanferkelschmaus mit Malvasierwein und den altertümlichen sardischen Rundtanz. Grund genug für Liebhaber sonderbaren Volkstums, um vor allem anderen an einen Besuch in Quarto zu denken, um so mehr, als die Reisehandbücher für den Weg dorthin noch einen anderen in Europa seltenen Genuß versprechen, nämlich den Anblick von Flamingos, die im Frühjahr den Strandsee bevölkern sollen. Die Ehrlichkeit gebietet mir, von vornherein mitzuteilen, daß von den in Aussicht gestellten Genüssen nur ein Teil sich verwirklichte, obwohl es im Frühjahr und noch dazu am Palmsonntag war, als wir morgens nach Quarto wanderten.
Ob die Flamingos nur in diesem Jahre fehlten, weil der Lenz recht kühl und naß ist, oder ob die fortschreitende Kultur sie überhaupt aus der Umgebung von Cagliari verdrängt hat, wage ich nicht zu entscheiden; jedenfalls sahen wir statt der Flamingos nur etliche blökende Schafherden, obwohl die landschaftliche Scenerie mit einem langgestreckten Palmenhain am Rande der Lagune für die rosafarbenen Sumpfvögel immer noch recht einladend sein muß.
Die moderne Kultur, die unter anderem eine Dampftrambahn zwischen der Provinzialhauptstadt und den Nachbardörfern bis Quarto geschaffen hat, ist aber gewiß daran mitschuldig, daß die vielgerühmten prunkvollen Trachten der Frauen von Duarto nur noch ganz vereinzelt zu finden sind und von den Einwohnern selbst als eine Erinnerung an vergangene Zeiten betrachtet werden.
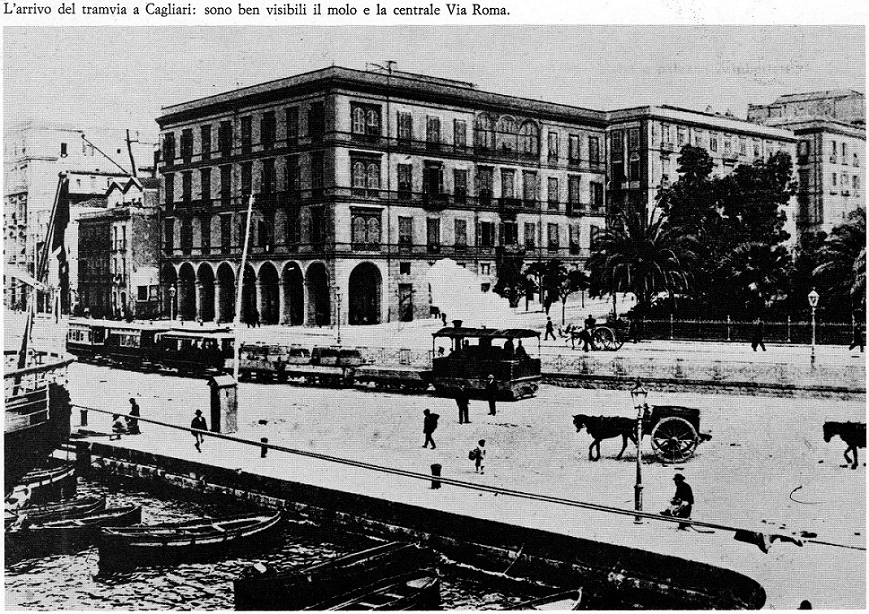
Der wirtschaftliche Rückgang des sardischen Bauernstandes überhaupt trägt natürlich auch das Seinige zu diesem beklagenswerten Wandel bei. Aber trok der Enttäuschung, die wir erfuhren, bot doch Quarto des Interessanten noch genug. Wir hatten die von Feigenkaktus eingefaßte Landstraße zurückgelegt, ohne auch nur einen einzigen Flamingo am Rande des Sumpfes zu sehen, und betraten das ausgedehnte Dorf, ohne einen Menschen zu erblicken. Unter Menschen verstanden wir selbstredend nur Kostümfiguren; die wenigen lebenden Wesen, die uns in den stillen schmutzigen Straßen begegneten, sahen aus wie allüberall in Europa. So kamen wir bis zur Kirche, die mit einem schlanken bunten Turm und der ziegelgedeckten Kuppel über einen kleinen Pinienhain hinwegragt.
Der freie Plak unter den Pinien war wie ausgestorben, nur zwei oder drei halbwüchsige Burschen in städtischer Kleidung lungerten da herum und bettelten uns nicht einmal an. Wir schauten einander mit langen Gesichtern an und fanden uns innerlich mit dem Gedanken ab, daß wir eben zu spät geboren waren, um Duarto in seinem Glanze zu sehen.
Eine traurige Inschrift neben dem Kirchportal schien uns darin bestärken zu wollen; denn da stand auf weißer Marmortafel zu lesen, daß am 5. Oktober 1889 ein fürchterlicher Wolkenbruch nicht nur die Felder der Gemarkung verwüstete, sondern auch 500 Häuser des Dorses zerstörte und neun Menschen unter den Trümmern begrub. Daß die aus ungebrannten Ziegeln erbauten Häuser einem gewaltigen Wasserstrom nicht Widerstand leisten konnten, ist allerdings zu begreifen, ein tüchtiger Plakregen kann in den Dörfern des Campidano von Cagliari und Oristano Verheerungen gleich einem Erdbeben anrichten.
Im übrigen machen aber die Bauernhäuser von Quarto keinen unsoliden Eindruck. Bei einer Wanderung durch die Straßen überzeugten wir uns, daß die Wohnungen meist geräumig, luftig und reinlich nach einem gleichbleibenden Grundplan angelegt sind. Nach der Straße ist das Anwesen durch eine hohe Mauer mit Einfahrtsthor abgeschlossen, dahinter liegt ein an deutsche Bauerndörfer erinnernder Wirtschaftshof, der außer einer Düngerstätte auch oft ein Fleckchen Grün und Blumen enthält; die Seiten des Vierecks werden durch Stallungen, Wohngebäude u. f. w. gebildet, die fast durchweg einstöckig und nach dem Hofe zu mit bedeckten Umgängen versehen sind. Das Bestreben, diesen Mittelpunkt des häuslichen Innenlebens recht schmuck und behaglich auszustatten, macht sich allenthalben geltend.
Besonders wurde unsere Aufmerksamkeit im Vorbeigehen durch einen Hof gefesselt, dessen weiße Loggia mit bunten Malereien kunstlos, aber nicht ungeschickt geziert war; zwischen Phantasielandschaften aller Art und Ansichten der italienischen Hauptstadt sah man die Bildnisse großer Italiener über den Säulen angebracht, das Königspaar, Garibaldi, Mazzini, Dante und Galilei.
Neugierig traten wir näher und wurden ehrerbietig von Knecht und Magd begrüßt, die sofort den Hausherrn Sor Antonio herbeiriefen. Da machten wir unvermutet eine Bekanntschaft, die der Mühe wert war. Nachdem wir dem Manne einiges Angenehme über die patriotischen Malereien an seinem Hause gesagt hatten, wurden wir freundlichst in das zu ebener Erde gelegene gute Zimmer genötigt, in welchem auch das sauber gedeckte Chebett stand, und dort auf den an der Wand aufgereihten Stühlen nebeneinander sikend, führten wir eine längere Unterhaltung über sardische Zustände. Sor Antonio, ein guter Sechziger, war wie die meisten Sarden Pessimist und malte die Lage des Bauernſtandes in den trübsten Farben; aber es war bei ihm nicht leeres Geschwäß oder oberflächliche Nörgelei am Bestehenden, sondern er hatte bessere Zeiten gesehen und konnte seine Ansichten mit eigenem Erfahrungsmaterial, vielfach auch mit Ziffern begründen.
Wein- und Kornpreise der früheren Jahre und der Gegenwart waren ihm geläufig, und so konnte er uns zeigen, wie heute der Anbau der wichtigsten Erzeugnisse des Campidano kaum noch lohnt; ehedem versorgte der Campidano die ganze Insel mit Wein, jekt wird er auch in höher gelegenen Teilen der Insel gebaut, und die Preise sind auf ein Drittel und weniger heruntergegangen; mit dem Getreide aus Taganrog kann nun gar das einheimische nicht in Wettbewerb treten, und mancher Besizer zieht vor, sein Feld überhaupt nicht mehr einzusäen, statt für einen zweifelhaften Ertrag Mühe und Kosten aufzuwenden. Den wesentlichen Grund dieser Notlage findet Sor Antonio in dem schweren Steuerdruck, der auf dem Grundbesis lastet, die Abgaben sind so hoch, daß mit ihnen ein Bauer ungefähr alle 10 Jahre sein Eigentum neukauft. Regierungsfreundlich war der alte derbe Herr also gar nicht, aber noch weniger gut war er auf das Parlament zu sprechen. Für ihn hörte die gute alte Zeit da auf, als die parlamentarische Verfassung ins Leben trat, und die Herren Abgeordneten ohne Unterschied der Partei belegte er mit nichts weniger als schmeichelhaften Tiernamen, wenn es auch die Namen der nüßlichsten Haustiere waren. Nach seiner Meinung, die gewiß nicht ganz irrig ist, gebrauchen die meisten Abgeordneten ihr Mandat nur, um selbst emporzuklettern, und wenn sie ihren Zweck erreicht und Geld und Macht erworben haben, dann kümmern sie sich keinen Deut mehr um ihren Wahlkreis und dessen Bedürfnisse; ebenso leben auch die Präfekten und anderen Beamten mehr der Regierung und sich selbst zu Gefallen als für die wahren Interessen der ihnen anvertrauten Bezirke.
Das Ende von dem ganzen Klagelied Sor Antonios klang in zwei Worte aus: Siamo abbandonati! (Wir sind verlassen und verloren!) Man kann sich danach schon denken, was unser Gastfreund antwortete, als wir nach den einst berühmten Kostümen von Quarto fragten.
Die kostbaren Festgewänder der Frauen mit dem zugehörigen Goldschmuck geraten immer mehr in Abnahme mit dem allgemeinen wirtschaftlichen Rückgang; es ist ja viel billiger, sich alla moda zu kleiden, und um ein kleines Vermögen in Schmuck anzulegen, dazu haben nur noch wenige die Mittel; die Männerwelt hat sich erst recht der althergebrachten Trachten entwöhnt. Nach Sor Antonios Schäßung sind in dem etwa 7000 Einwohner zählenden Dorf nur noch ein Dukend Frauen, die an hohen Festen die reiche Tracht der Vorzeit anlegen, und von den Männern tragen nur drei noch originell quartesisches Gewand. Am Palmsonntag würden wir aber auch beim Kirchgang nichts von der alten Kostümpracht zu sehen bekommen, da es Zeit der Buße sei, wohl aber am Ostersonntag.
Sor Antonio mochte wohl merken, wie unerfreulich uns diese Mitteilung war, denn nun rief er seine Frau herbei, ließ sie eine Flasche trefflichen Malvagiuweines auftragen und hieß sie ihre eigenen Prunkkleider aus der Jugend bringen, die sie gewissenhaft aufbewahrt hatte. Das war allerdings eine Augenweide, was da nun auf der weißen Bettdecke ausgebreitet wurde: drei Garnituren von Samt- und Seidegewändern, die beste von scharlachrotem, feingefälteltem Samt mit fußbreiter Seiden- und Goldbrokatborte, die Blumen und Vögel auf weißem Grund zeigt, schwarze, knappsikende Samtjacken mit Silberknöpfen und Spikenbesak, seidene Schürzen mit großen bunten Blumenmustern und der weiße blumenbestickte Schleier, der über den Rücken bis an die Knie doppelt herunterfällt. Schließlich brachte die gute Alte behutsam trippelnd noch eine Pappschachtel mit der wohlbekannten Inschrift „Hoffmanns Stärke“; das war ihr Schmuckkasten. Er enthielt für einige tausend Franken Goldgeschmeide, Ketten, Ringe, Anhenker, Broschen, Ohrringe und Knöpfe, vieles mit Perlen oder bunten Steinen besekt und von jener reichen, zierlichen Arbeit, die im südlichen Sardinien sich als ein Ueberbleibsel phönizischer Kultur durch Jahrtausende erhalten hat.
Und in der That, kaum hatten wir den Hof Sor Antonios verlassen, da strömte es durch alle Straßen heran wie ein historischer Festzug von Frauen. Die Männerwelt, die sich als „Kirchenvorstand“ unter dem Pinienschatten des Kirchplakes aufgestellt hatte, bildete die langweilige Alltagsfolie zu dem feierlichen Aufzug der Frauen und Mädchen, die in kleinen Gruppen von allen Seiten herankamen, das Haupt unter dem langen schwarzen Kopftuch sittsam gesenkt, die Hände mit Gebetbuch und Rosenkranz unter dem Busen gefaltet, während ihnen die Magd oder ein Kind den Kirchenstuhl nachtrug.
Man stelle sich vor, wie eigenartig dieses Zusammenströmen von etwa zweihundert gleichmäßig gekleideten Weibern wirkte, die mit ruhigem elastischem Schritt, der die fußfreien Röcke anmutig schaukeln ließ, daherkamen.
Der Kleiderrock fällt vor allem ins Auge und gibt dem Kostüm einen frohen Charakter; er ist schmal rot und blau gestreift, vorn glatt, aber an den Seiten und rückwärts so geschickt in feine Falten gelegt und gebügelt, daß die blauen Streifen völlig in die inneren Falten fallen und bei ruhiger Haltung der Rock gleichmäßig scharlachrot erscheint; durch die Bewegung aber öffnen sich die Falten nach unten in anmutigem Rhythmus und geben dem Stoff das Aussehen der in der Modesprache changeant genannten Seidenstoffe. Eine schwarze buntgeblümte seidene Schürze, die anschließende schwarze Jacke von polnischem Schnitt mit silbernen Kugelknöpfen an den Aermeln, ein buntes Tuch ums Haar gewunden und darüber das bis auf die Hüften dreieckig herabfallende schwarze Schleiertuch, das auch die Stirne beschattet und die Schultern bedeckt, vollenden den Anzug. Die meisten jungen Mädchen hatten dieses Tuch nach der unteren Ecke hin mit Blumen und Vögeln in bunter Seide gestickt; einzelne trugen auch etwas Goldschmuck an Brust und Hals und viele Ringe an den Fingern.
Das lebhafte Interesse, das wir an dieser seltenen Kostümparade nahmen, mag uns entschuldigen, wenn wir während des Gottesdienstes weiter nichts thaten, als die weiblichen Kirchgänger mustern; im übrigen konnte uns niemand vorwerfen, daß wir die fromme Andacht gestört hätten, denn die Verteilung der geweihten Palmen ging so wenig feierlich und mit so viel Geschrei vor sich, als ob es eine öffentliche Versteigerung wäre.
Aber nicht nur aus Höflichkeit gegen das schöne Geschlecht, sondern auch aus reiner Wahrheitsliebe muß ich dagegen hervorheben, daß die Mädchen von Quarto sich vor der übrigen Gemeinde durch eine Haltung voll sinniger Frömmigkeit auszeichneten und in ihren Bewegungen wie in der gegenseitigen Begrüßung, die in einem Händedruck mit einem stereotypen, uns unverständlich gebliebenen Gemurmel besteht, dem Charakter würdiger Gemessenheit alle Ehre machten, der der sardischen Bevölkerung von alters her nachgerühmt wird und auch noch nicht völlig geschwunden ist. Wir schieden aus Quarto mit dem Gefühl der Befriedigung, doch noch einen Rest guter alter Sitte gefunden zu haben, wenn auch der Dampftram, mit dem wir nach Cagliari zurückfuhren, uns daneben die trübe Ahnung erweckte, daß die nivellierende moderne Kultur über ein Weilchen auch jenen lekten Rest hinweggewischt haben wird.
DRITTE REISE, April 1898
* EIN RITT DURCH DIE BERGWILDNIS DER BARBAGIA
Den würdigen Abschluß unserer Reise sollte eine Fahrt durch den abgelegensten und urwüchsigsten Teil der Insel bilden, durch die um den Gebirgsstock des Monte Gennargentu liegende Barbárgia. (Die Reisehandbücher lassen in diesem Namen fälschlich das zweite r aus.)
Dieser Ausflug hat eine kleine Vorgeschichte, die für seinen Verlauf nicht ganz unwesentlich ist. Als wir nämlich im Café Aragno zu Rom unseren Reiseplan schmiedeten, schlug ich als alter Freund der Insel Sardinien einen Ritt durch die noch nicht von der Eisenbahn entweihten Berggründe der Barbárgia vor, wo Wildschwein und Mufflon einander gute Nacht sagen und der sardische Bandit sein gelobtes Land findet. Bis Sorgono sollte uns die Nebenbahn bringen, und von dort würden wir etwa 60 bis 70 Kilometer zurücklegen bis nach Nuoro, wo wir eine andere Nebenbahnlinie erreichen würden.
Einer von uns dreien, der auch Zeitungen liest und wußte, daß in der Umgebung von Nuoro jeden Tag ein Toter allein auf weiter Flur gefunden wird, schüttelte dazu bedenklich das Haupt und meinte, man unternehme keine Osterferienreise, um das Gruseln zu lernen. Auch wies er auf eine Stelle im Bädeker, wo es heißt, man solle dorten keine Ausflüge ohne Carabinieri geleitunternehmen. Da meine Versicherung, ein harmloser Fremder laufe dort keine Gefahr, nicht sofort wirkte, versprach ich, zuvor den Nat des sardischen Abgeordneten des Wahlkreises Jsili-Sorgono einzuholen, des damaligen Landwirtschaftsministers Cocco-Ortu.
Der Minister empfing mich sehr freundlich, lächelte über die Bedenken wegen der öffentlichen Sicherheit und schrieb mir einen Empfehlungsbrief an den Bürgermeister von Sorgono, der uns in jeder Weise mit Rat und That unterstüken würde. Nach dieser Vorsichtsmaßregel wurde der Ritt ins alte romantische Land einstimmig beschlossen und dem Sindaco von Sorgono unsere Ankunft auf Tag und Stunde vorher angekündigt.
So fuhren wir, nachdem wir in Cagliari wieder sardischen Boden betreten hatten, in der Morgenfrühe eines Freitags auch das noch mit dem einzigen Zuge, der täglich die Hauptstadt der Insel mit Sorgono verbindet und fast neun Stunden auf der 165 Kilometer langen Strecke liegt, wohlgemut ab.
Der Zug hatte zwei Personenwagen, deren einer erfrischende Vorbedeutung – ausschließlich für Carabinieri und deren gefesselte Pflegebefohlene bestimmt war. Der andere Wagen enthielt je ein Abteil erster und zweiter Klasse, worin sich ein einsamer Hauptmann der Carabinieri langweilte, und ein Abteil dritter mit einem Dukend Insassen: außer uns ein paar Dorfpfarrer, die gleich den Bauern ihr Gepäck in rohwollenen Doppelsäcken mitführten, zwei Hirten mit zottigen Ziegenfellmänteln, einige Bauern und Holzhacker, die ihre Aexte und die weingefüllte Kürbisflasche (zucca) unter die Bank warfen, und eine junge Frau in bunter Landestracht mit einem Säugling.
Die Männer schauten alle struppig und wild genug aus; die schwarze lange Sackmüße, das gleichfarbige rauhe Wams, die steife braune Lederweste, die weite leinene Hose mit dem kurzen schwarzen Lendenschurz darüber und den schwarzen Gamaschen darunter erhöhten den düsteren Eindruck.
Anfänglich wurden wir Fremdlinge nur stumm angestaunt; später, als durch irgend einen Anlaß das Eis gebrochen war, entspann sich zwischen uns und den Einheimischen eine lebhafte Frage- und Antwortunterhaltung, soweit die beiderseitigen Sprachkenntnisse es gestatteten, denn manche von den Leuten sprachen nur sardisch, nicht italienisch.
Man hielt uns für Holzhändler, da es nach dem Denkvermögen der Barbargianer für die Reise eines Fremden in jener Gegend keinen anderen Grund als das Holzgeschäft geben kann. Unseren wirklichen Reisezweck konnten wir den guten Leuten nicht begreiflich machen, sie lächelten blöde zu unserer Antwort, daß wir uns das Land ansehen wollten, und nur die junge Mutter schwang sich mit weiblichem Scharfsinn zu der Bemerkung auf, wir hätten wohl alle Tage festa (Feiertag). So waren wir zu nuklosen Müßiggängern gestempelt.
Müßig waren wir darum doch nicht, denn eine gute halbe Stunde verbrachten wir mit der fleißigen Vertilgung der mitgenommenen Eßvorräte, worauf der muntere Säugling unermüdlich mit den Papierumhüllungen spielte, und die übrige Zeit schauten wir die wechselnden Landschaftsbilder an.
Anfangs, während die Bahn in weiten Bogen an den baumlosen, mit Korn und Weideland bedeckten Vorhöhen hinansteigt, sieht man noch über die Tiefebene von Cagliari nach dem Meer hinüber, dann erblickt man von der welligen Hochfläche, deren grüner Teppich von Felsgeröll und niederem Gestrüpp unterbrochen wird, in der Ferne den schneebedeckten, lang hingezogenen Kamm des in der Punta Bruncu Spina bis zu 1940 Meter aufsteigenden Monte Gennargentu, und dann dringt man bei Nurallao und Laconi in das wildmalerische Bergland ein, wo tiefe Thäler mit rauschenden Gewässern, schroffe, kühngeformte Basalt- und Granitmassen, saftgrüne Halden und dichter, finsterer Wald von Korkeichen, Steineichen und deutschen Eichen wechseln.
Es ist eine mächtige Landschaft mit einem melancholisch einsamen Gepräge. Die zu den weit voneinander liegenden Stationen gehörigen Orte sind von der Bahnstrecke aus nur zum kleinen Teil sichtbar. Bei Ortuabis und BelviAriko erreicht die Bahn ihren höchsten Punkt, fast 800 Meter über dem Meer, und der Bau der Linie erinnert vielfach an den berühmter Alpenbahnen; an einer Stelle sieht man wie auf der Gotthardbahn bei Wasen das Geleise dreimal übereinander an den Thalwänden hinziehen. Die Reisegesellschaft wechselte während der neunstündigen Fahrt nur sehr wenig; wer ausstieg, wünschte mit biederer Herzlichkeit allen anderen gute Weiterreise, und ein gegen das Ende der Fahrt zugestiegener Gefährte, der als einziges Gepäck eine Büchse mitführte, erquickte uns mit der Erzählung eines Ueberfalls, dem im vergangenen Jahre zwei französische Holzhändler in jenen Bergen einen mehrtägigen Freiheitsverlust zu verdanken hatten. Dieser Bericht und der Umstand, daß die Hälfte aller Menschen, die wir unterwegs sahen, Carabinieri waren, erweckte von neuem Bedenken in unserer Reisegesellschaft.
Eine Wolke, die sich auf dem Antliß eines Gefährten lagerte, reizte mich zu einem verwegenen Scherz. Ich legte mein Gesicht in die ernstesten Falten und sagte: „Meine Herren, ich muß Sie bitten, mir für die lekten Reisetage mit Ihren Barmitteln auszuhelfen.
“ – „Warum, – haben Sie Ihr Geld verloren ?“ war die erstaunte Gegenfrage.
„Das nicht, aber ich werde von Sorgono aus all mein Papiergeld per Post nach Rom senden, damit es mir auf dem Ritt durch das romantische Land nicht abgenommen wird. „
„Nun seht den naiven Egoisten,“ rief der eine, und der andere: „Das ist doch nicht Ihr Ernst! sonst wünschte ich Ihnen wahrhaftig, daß der Postwagen, der Ihren Mammon befördert, unterwegs von Räubern ausgeplündert wird. “ Dieser fromme Wunsch erfüllte sich aber ebensowenig wie die Besorgnisse um unsere persönliche Sicherheit. Denn als wir auf dem Bahnhof Sorgono ankamen, bemerkten wir sofort, daß für uns sehr gewissenhaft vorgesorgt war.
SORGONO
Der Bürgermeister und der Gemeindesekretär empfingen uns am Bahnhof und eröffneten uns, der Minister Cocco-Ortu habe dem Sindaco in einem längeren Briefe unser Wohl ans Herz gelegt, es stünden für unsere Weiterreise Pferde und Führer bereit, und die Carabinieriposten längs des Weges würden von unserem Kommen in Kenntnis gesekt.
Ein uns freundlichst angebotenes Mahl im Bürgermeisterhause lehnten wir ab und hielten uns nur, während die Pferde gesattelt wurden, bei einem Glase Wein und einem Teller mit Gebäck in der guten Stube des Sindaco, die mit den Bildnissen sämtlicher savoyischer Fürsten von Karl Albert an geschmückt war, in lebhafter Unterhaltung auf.
Als die Frage eines Carabinierigeleites gestreift wurde, that uns der Gemeindesekretär die überraschende Weisheit kund, es sei sicherer, ohne Bedeckung zu reisen, da diese nur die Aufmerksamkeit unnük auf uns ziehen und bei etwaigen Interessenten den Glauben erwecken könnte, wir trügen große Werte bei uns.
In diesem Augenblick rutschte ich unruhig auf meinem Stuhle hin und her, erhob mich, sprach leise mit dem Sekretär und verließ mit ihm das Zimmer. Nach zehn Minuten kehrte ich zurück und sagte im Tone der vollsten Befriedigung: „Ich bin reisefertig; soeben habe ich meinen Mammon der Post anvertraut. “ Das betroffene Gesicht meines Nachbarn werde ich nie vergessen. Er bemerkte zwar nur: „Das war nicht schön von Ihnen,“ aber in seinen Augen las ich etwas anderes: Der verfl… Kerl ist mir zuvorgekommen!


OVODDA
Um fünf Uhr ritt unsere kleine, aus vier Mann bestehende Karawane, von allen ortsanwesenden Sorgonesen angestaunt und von dem schwarzbezipfelten Vincenzo Merreo geführt, zum Dorf hinaus. Der Sindaco hatte mich noch mit einer Empfehlungskarte an den Gemeindesekretär von Ovodda versehen, bei dem wir die Nacht zubringen sollten, denn Wirtshäuser gibt es in den kleinen Bergnestern nicht.
Unser Führer Vincenzo war ein ernster, schweigsamer Mann; er sprach nicht viel, weil er nicht viel wußte. Selbst die Entfernungen des Weges, den wir zurückzulegen hatten, waren ihm unbekannt; er gab sie, wie es ihm gerade einfiel, bald auf so viel, bald auf so viel Stunden an. Ich machte hierbei wieder dieselbe Erfahrung wie im Jahre 1892 mit Michele Uliva, der mich nicht rechtzeitig nach Tempio hatte bringen können, weil er von Zeit und Entfernungen auch keine Ahnung hatte.
Diesmal ging es für den ersten Abend etwas besser, denn wir erreichten wenigstens unser Ziel Ovodda, wenn auch erst in völliger Dunkelheit um neun Uhr, nachdem wir bei Sonnenuntergang von einer hohen Wegebiegung oberhalb des Dörfchens Tiana ein herrliches Gebirgspanorama bewundernd überschaut hatten.
Mit dem Kopf an die Dächer der Häuser anstoßend, ritten wir in die engen, finsteren Gassen von Ovodda hinein und überraschten den Gemeindesekretär Marcello mit Klopfen an seinem verschlossenen Hofthor. Aber trok seiner völligen Unbereitschaft wurden wir dank der Empfehlung des Sindaco von Sorgono ohne Umstände herzlich aufgenommen.
Es währte allerdings lange, bis Licht angezündet war und wir uns in der schlichten Bauernstube umschauen konnten, deren Dielenboden an verschiedenen Stellen auch Durchblicke in das darunter liegende Gemach gestattete. Noch länger dauerte es, bis ein einfacher Imbiß hergerichtet war, denn es war ja Freitag und kein Fleisch im Hause. Aber die hungrige Wartezeit vertrieb uns der neue Gastfreund in der anstoßenden guten Stube, wo außer einem breiten Sofa auch zwei reingedeckte Betten standen, mit einer Unterhaltung über den Zweck unserer Reise und über die Verhältnisse seines Dorfes.
Da hörten wir die üblichen Klagen über den Mangel an Fürsorge seitens der Abgeordneten und der Regierung, über die Armut und wirtschaftliche Indolenz der Bevölkerung, die nicht verstehe, dem Boden mehr abzugewinnen, als er ganz aus freien Stücken gebe, aber auch Lob über die Bravheit, Ehrlichkeit und Genügsamkeit der Leute, unter denen keinerlei gefährliche Elemente seien. Die Korkeichen, die Viehzucht auf freier Weide, die Jagd und ein wenig Korn- und Weinbau für den Hausbedarf bilden die wesentlichsten Erwerbsquellen der Bergbevölkerung.
Nach einem Willkommtrunk von Aquavita wurden wir endlich an den gedeckten Tisch geführt. Ein Teller voll warmer Milch, Brot von zweierlei Art, eines davon wie ein papierdünner, knusperiger Fladen, Ziegenkäse, ein Rest von Gelatina mit Fleischknochen und ein feuriger Rotwein bildeten das Mahl, das uns bis gegen elf Uhr zusammenhielt.
Dann suchten wir eilig das Schlafgemach auf, da wir schon in der Frühe weiterzureiten gedachten. Der freundliche Hausherr bat uns, zu dreien mit den beiden Betten vorlieb zu nehmen, ließ uns das einzige Waschbecken frisch füllen und legte auch eine Zahnbürste dazu.
Ich wickelte mich in meinen tunesischen Burnus und streckte mich auf das Sofa, während die beiden Gefährten die Betten erkletterten. Ein zweistimmiges Freudengeheul ließ mich nochmals die Augen öffnen: die beiden hatten jeder auf seinem Kopfkissen eine reine weiße Zipfelnachtmüze gefunden und bedeckten damit in gegenseitiger Bewunderung ihre Köpfe. Und dann fielen uns, was nach dem ungewohnten vierstündigen Reiten sehr begreiflich war, sofort die Augen zu.
NUORO
Um fünf Uhr morgens erhielten wir als Frühstück ein Gläschen Aquavita, schüttelten dem Gastfreund Marcello, der jedwede Entschädigung würdevoll ablehnte, mit herzlichem Dank die Hand, und fort ging es wieder zu Pferd in den kühlen, feuchten Morgen hinein. Unsere Absicht war, gegen Mittag das berüchtigte Städtchen Nuoro zu erreichen, wo wir um: zwei Uhr die Nebenbahn zur Weiterfahrt benußen wollten. Aber nun begannen die Ueberraschungen, die uns der über Raum und Zeit gleichermaßen unklare Führer Vincenzo bereitete. Es bedurfte unserseits der Zusammenfassung alles verfügbaren guten Humors und aller physischen Spannkraft, um nicht die Geduld zu verlieren und bei allem Aergernis doch noch einigen Genuß von dem Ritt durch die feierlich einsame Berglandschaft zu haben.
Die ersten drei Stunden ging es noch gut; wir erreichten, vorbei an schönen Thalgründen und korkeichenbewachsenen Felshängen, mit dem Rückblick auf die beschneiten Gipfel des Gennargentu, um 81/2 Uhr das Dorf Gavoi, wo wir in dem Hause eines gastfreien Bauern uns an Käse, Brot und Wein stärkten. Hier erfuhren wir, daß wir nur dann zur gesekten Frist in Nuoro eintreffen könnten, wenn wir kurz hinter Gavoi die Landstraße verließen und einen Reitweg über Berg und Thal einschlügen. Diesen Weg kannte jedoch Vincenzo nicht, und wir mußten in dem Dorf einen zweiten Führer suchen, der unseren Führer führte.
Waren wir bisher auf der Landstraße noch ab und zu einem plumpen Ochsengefährt, einem Paar Carabinieri, einigen berittenen Bauern begegnet, so war von nun an fünf Stunden lang der Weg fast völlig menschenleer, und wir sahen bis zur Ankunft in Nuoro, so weit der Blick reichte, keinen bewohnten Ort mehr, höchstens ein halbes Dußend einzelner Hütten und hier und da einsam weidende Herden von Rindvieh und Schafen unter der Obhut eines zottigen Hirten.
Der Weg war bald steinig, bald sumpfig, bald ging er über saftigen Rasen unter alten Eichen durch, die unsere Hüte festzuhalten drohten, bald durch rauschende Bäche.
An landschaftlichem Reiz fehlte es nicht; die 1082 Meter hohe steile Pyramide des Gonnari mit dem Kirchlein auf der Spike, das üppig bewachsene Thal des Olienabaches, die großartige kahle Felskette der Punta Cerrasi und die mächtige Bergscenerie um Nuoro herum waren hervorragende Schönheiten.
Aber immer vernehmlicher knurrte der Magen, so daß wir unsere Pferde beneideten, die unterwegs ab und zu ein Maul voll frischen Grases mitnehmen konnten, und immer deutlicher fühlten wir unsere des langen Rittes ungewohnten Glieder. Nuoro wollte sich nicht zeigen, obwohl die angegebene Wegzeit bereits überschritten war; es war uns nicht mehr zweifelhaft, daß unsere beiden Führer auch mit vereinten Kräften den nächsten Weg nicht hatten finden können.
Wären wir des Sardischen mächtig gewesen, so hätte Vincenzo Merreo wohl mehr als einen saftigen sardischen Fluch von uns zu hören bekommen; was wir ihm aber im italienischen Konversationston sagten, das glitt an seiner bewunderungswürdigen Gleichgültigkeit vollständig ab, wie der Regen, der uns zu allem Ueberfluß noch zu durchnässen begann, an seiner rauhen sardischen Tuchjacke. In seinem eckigen Schädel unter der schwarzen Sackmüze mag er sich wohl seine eigenen Gedanken darüber gemacht haben, daß es Menschen in der Welt gibt, die zu einer bestimmten Stunde an einem bestimmten Orte zu sein verlangen.
Es ging auf ein Uhr nachmittags, als wir die Landstraße wieder erreichten. Aber von Nuoro war noch keine Spur zu sehen, nur ein einsames Wegwärterhaus lag an der Straße. Allmählich begann sich die Gegend wieder zu beleben. Von neuem trafen wir ein paar schwerfällige Ochsenwagen mit ins Feld fahrenden Bauern, auch die Carabinieri blieben nicht aus, und in Feld und Wiesen tauchten vereinzelte schwarz-weiß- rote Gestalten auf; die Bauern im Nuoresischen pflegen nämlich die düstere allgemein-sardische Tracht durch Hinzufügung einer scharlachroten Weste oder durch rotes Futter des schwarzen Kapuzenmantels aufzuheitern, während sie selbst gerade so melancholisch und finster dreinschauen wie das übrige Sardenvolk.
Man begann die Nähe eines bewohnten Ortes zu fühlen, und auf die Frage, wann wir in Nuoro sein würden, gaben unsere Führer die tröstliche Antwort: subito! Nach unserer Kenntnis der italienischen Sprache durften wir nunmehr hoffen, wenigstens in einer Stunde am Ziel zu sein.
Es dauerte aber noch um ein Weilchen länger. Als wir um zwei Uhr immer nur Hügel, Weiden und Felder sahen, ertönte auf einmal der langgezogene Pfiff einer Lokomotive aus unbestimmter Ferne. Wir blinzten einander verständnisinnig an: das war unser Eisenbahnzug, der gerade die Station Nuoro verließ. Aber niemand verlangte jekt mehr nach ihm; mochte er zum Teufel fahren, unser Sinn war nur noch auf einen gutbesekten Tisch und auf ein Ruhelager gerichtet, das aussehen mochte wie es wollte, wenn es nur kein Pferdesattel war; denn wir saßen nun fast ohne Unterbrechung über acht Stunden im Sattel.
Wir fanden, was wir wünschten, in Nuoro, wo wir um halb drei Uhr einritten, und zwar fanden wir es dank der berüchtigten Unsicherheit der Umgebung.
Seit einigen Jahren liegen nämlich in Nuoro zur wirksameren Unterstüßung der Carabinieri einige Compagnieen Infanterie, und seitdem hat ein rühriger toscanischer Wirt ein einfaches, aber anständiges Gasthaus eingerichtet, in welchem die Offiziere ihre gemeinsamen Mahlzeiten einnehmen. Heute saß mit ihnen auch der durch die Feldzüge in Erythräa bekannte General Stevani zusammen, den die Regierung wegen des unaushaltsamen Wachstums der Unsicherheit zu einer außerordentlichen Inspektion ins Nuoresische entsandt hatte.
Seine Anwesenheit an dem durch den öffentlichen Sicherheitsdienst entstandenen „Tischlein-deckdich“ war eigentlich das erste Lebenszeichen, welches uns an diesem Tage das Nuoreser Banditentum gab; unterwegs hatten wir nicht das geringste davon bemerkt. Das zweite Lebenszeichen der Banditen fanden wir in der lekten Nummer einer Zeitung aus Sassari, in der wir während des Essens lasen, daß in den gerade vergangenen Ostertagen bei Nuoro und in dem schönen einsamen Olienathal wieder zwei Morde verübt worden sind, ohne daß man die Thäter kennt. Von dem einen Opfer hatte man den abgeschnittenen Kopf an einer Eiche aufgehängt gefunden.
„Sehen Sie, wie sehr ich recht gehabt hätte, mein überflüssiges Geld nach Nom vorauszusenden,“ bemerkte ich dazu verschmist lächelnd, indem ich aus meiner Brieftasche einen größeren Schein zog und dem Wirt zum Wechseln hinreichte. Meine Gefährten rissen die Augen vor Staunen auf, als sie mich noch im Besiz von Geld sahen, und riefen dann einstimmig: „Wäre auch sehr überflüssig gewesen, Ihre paar Gräten vorauszusenden; denn was gehen uns harmlose Ferienreisende die Streitigkeiten der Nuoresen untereinander an ?“
„Das habe ich Ihnen ja immer gesagt,“ fügte ich hinzu; dann aber faßten wir noch einen einstimmigen Beschluß, bevor wir unsere von der cavalleria rusticana zerschlagenen und geschundenen Glieder aufs Bett streckten, und der lautete: Wer auf Vergnügungsreisen nur Vergnügen und Bequemlichkeit sucht und Anstrengungen scheut, der kann wohl nach Afrika reisen, aber er meide das Innere von Sardinien, vor allem die Barbárgia, denn sie führt ihren Namen mit Recht.
DER BERÜHMTE BANDIT GIOVANNI TOLU
* EIN SARDISCHES BANDITENLEBEN
In Porto Torres starb 1896 der berühmte Bandit Giovanni Tolu. Da über seine Thaten im Volksmund und durch die Zeitungen vielerlei Märchenhaftes verbreitet war, so hat Tolu selbst darauf gehalten, der Nachwelt seine Lebensgeschichte wahrheitsgetreu zu überliefern, und einige Monate vor seinem Tode dem in Sassari lebenden Schriftsteller Costa seine Selbstbiographie in die Feder diktiert. Zwei Oktavbände mit zusammen 770 Seiten enthalten diese merkwürdige Erzählung, die den Leser als documents humains und als Beitrag zur Kenntnis der sardischen Kultur in gleichem Maße fesseln. Ergänzend und berichtigend kommen an einzelnen Stellen die Forschungen des Herausgebers, der die Gerichtsakten und andere Urkunden geprüft hat, in Form von Anmerkungen dazu; sonst aber bewahrt die Erzählung, wenn auch die sardische Mundart des Banditen in allgemein verständliches Italienisch übersekt ist, den individuellen Charakter der Selbstbiographie. Giovanni Tolu ist ein Typus, allerdings einer von denen, die auch auf dem zäh konservativen Boden Sardiniens immer seltener werden; wer dieses seltsame Leben vor sich aufrollen sieht, darf nicht glauben, daß die sprichwörtlich gewordene Unsicherheit der Insel nur durch das Vorhandensein von Leuten vom Schlage Tolus bedingt werde.
Die Tolu und Genossen bilden gewissermaßen die Aristokratie des sardischen Verbrechertums, dessen Mehrzahl ebensogut wie anderwärts aus gemeinem Gesindel besteht, das kein besonderes Interesse, geschweige denn Sympathie erwecken kann. Bevor ich den Leser mit den Schicksalen Giovanni Tolus bekannt mache, muß ich vor einem naheliegenden Mißverstehen des Begriffes Bandit warnen. Der Bandit ist nicht, wie ich mit Staunen sogar in den angesehensten deutschen Konversationslexika lese, ein berufsmäßiger gedungener Meuchelmörder. Viele ließen und lassen sich wohl zu diesem Handwerk gebrauchen, aber ursprünglich ist der bandito nichts anderes als der Verbannte, Geächtete, der wegen einer begangenen strafbaren That oder eines auf ihm lastenden Verdachts seinen Wohnsiz verlassen hat und vor der ihn verfolgenden Justiz flieht. Immerhin ist ein Zerwürfnis mit dem Gesek stets der Ausgangspunkt für die Laufbahn des Banditen, den das Verhängnis dann von Verbrechen zu Verbrechen treibt, so daß es nur selten einem beschieden ist, im Frieden mit der Gerechtigkeit zu sterben wie Giovanni Tolu.
Unser Held wurde als Kind armer fleißiger Bauern in dem Dorfe Florinas unweit Sassari am 14. März 1822 geboren. Streng und gottesfürchtig erzogen diente Giovanni vom 9. bis zum 12. Jahre mit großem. Eifer als Sakristan und rühmte sich, hierbei eine gründliche Kenntnis der dottrina cristiana und aller kirchlichen Verrichtungen erworben zu haben. Dem Schulbesuch dagegen entzog er sich, wie er nur konnte. Lesen und Schreiben hat er erst spät in der Einsamkeit des Banditenlebens gelernt, das Schreiben erst durch den Briefwechsel mit seiner Tochter, für deren gute Erziehung er rührende Sorge trug, während er von den Gendarmen verfolgt in der Wildnis lebte. Einer der überraschenden schönen Züge in dem Charakter eines Mannes, der mit kaltem Blut ein Dukend Menschen umgebracht hat! Die gewissenhafte Frömmigkeit, die er sich im Meßdienst angeeignet hatte, bewahrte sich der seltsame Mensch durch sein ganzes Leben. Wenn er einen Mord begangen, versäumte er nie, für die Seele des Getöteten zu beten, und begründet dies in seiner Biographie mit den Worten: „Ich habe nie die Seele meiner Feinde getötet; sie gehört Gott und muß zu Gott zurückkehren, der Körper aber ist Erde und muß wieder Erde werden. “Während der dreißig Jahre seiner Banditenlaufbahn hat Tolu immer eine Bibel und ein Marienbrevier bei sich getragen und stets seine „Pflicht gegen Gott und die Heiligen“ erfüllt. Mit dieser Frömmigkeit verband sich von Kindesbeinen auf ein unerschütterlicher Aberglaube, und der ist ihm verhängnisvoll geworden. Nachdem der Knabe drei Jahre lang Mesnerdienste geleistet hatte, warf er sich mit leidenschaftlichem Eifer auf die bäuerlichen Beschäftigungen.
Feldarbeit war seine größte Freude, er wurde stark und gesund dabei und brachte durch seine Rührigkeit einen gewissen Wohlstand in das Elternhaus. So konnte er schon als junger Bursche für sardischen Bauernsport, wie Reiten und Scheibenschießen, etwas draufgehen lassen; die Triumphe auf dem Schießstand waren seine vorzügliche Sonntagsfreude. 25 Jahre war er alt, als ein Mädchen Namens Maria Francesca, das mit seiner Tante im Dienst des Pfarrers Pittui stand, sein Auge und sein Herz fesselte. Der Pfarrer aber schickte Giovannis Mutter, die nach Landesbrauch als Brautwerberin für ihren Sohn kam, mit einer nicht sehr freundlichen Vertröstung auf später heim. Von da an sah der in seinem Stolz gekränkte Freier, ob mit Recht oder Unrecht, in dem Pfarrer Pittui seinen schlimmsten Feind. Auch seine persönliche Werbung wies der Priester ab, und als Tolu drohte, Maria Francesca auch ohne Einwilligung ihres Dienstherrn heimzuführen, antwortete der Priester zornig: „Dann werde ich ihr nichts mitgeben,“ worauf ihm Tolu schlagfertig erwiderte: “Desto besser für mich; ich lebe dann um so ruhiger ohne die üble Nachrede, die sich an Eure Mitgift knüpfen würde! Ihr versteht mich!“ Der Pfarrer verstand nur zu gut und blieb unversöhnlich. Nach Tolus Ueberzeugung rächte sich Pittui damit, daß er den standhaften Brautwerber behexte, indem er ihm die fattuchierie oder legatura machte. Tolu fühlte das sehr bald am eigenen Leibe; er empfand heftige Gliederschmerzen und fühlte sich wie zerschlagen, am schlimmsten war sein Zustand immer am Vorabend kirchlicher Festtage. In seiner Verzweiflung wandte sich der Kranke an alle berühmten Zauberbanner der Umgegend, um Heilung zu erlangen, meistens auch Geistliche, die den Kranken unter Ablesung einiger Seiten des Breviers mit Weihwasser besprengten.
Aber alle Beschwörungen blieben erfolglos. Inzwischen erhielt Tolu das Jawort Maria Francescas und ihrer y Eltern, und das feierliche Verlöbnis erfolgte; der Brautstand wurde aber durch Tolus Krankheit und seine verzweifelten Versuche, Heilung zu finden, getrübt. Schließlich bemerkte der Arme, daß der Zauber auch sein Pferd betroffen hatte. Als eine Zeit der Besserung eintrat, beschleunigte der Bräutigam die Vermählung. Ein anderer Pfarrer von Florinas prüfte das junge Paar in der Christenlehre; Tolu erzählt mit Stolz, daß er gut bestand, während seine Braut, obgleich im Hause eines Priesters ausgewachsen, sehr wenig wußte. Tolu versprach, den versäumten Unterricht seiner künftigen Gattin nachzuholen, und am 17. April 1850 wurde die Ehe geschlossen. Mit einer rührenden Einfalt schildert Tolu die erste Zeit seines häuslichen Glücks. Aber der Pfarrer Pittui wußte immer nach Tolus Erzählung Wirrsamen in die junge Che zu streuen; in einer Meinungsverschiedenheit über einen Wohnungswechsel stachelte er die Frau gegen ihren Gatten auf, überhäufte Tolu mit Beleidigungen und bewog die Eltern Maria Francescas, die Tochter in ihr Haus zurückzunehmen. Tolus verbitterte Stimmung steigerte sich, als mit dem Winter auch die körperlichen Leiden wiederkehrten; der verhängnisvolle Pfarrer fuhr fort, ihn mit seinen teuflischen Zauberkünsten zu verfolgen“. In seiner Verzweiflung machte der Gequälte in der Morgenfrühe des 27. Dezember 1850 einen Mordanfall auf Pittui, aber die Pistole versagte. Außer sich vor Wut, weil der Pfarrer nun auch noch die Waffe behext habe, stürzte sich Tolu auf ihn und schlug ihn mit der Faust zu Boden; aber Nachbarn kamen hinzu, und nach einem verzweifelten Kampfe lief Tolu nach seinem Hause, während die herbeigeeilten Männer dem schwerverlekten Pfarrer Hilfe leisteten, ergriff die Büchse, schwang sich auf sein ungesatteltes Pferd und jagte aus dem Dorfe hinaus.
Nun war er ein Bandit, verfolgt von der Justiz und von der Nache des Priesters, der ihm seine Freunde auf den Hals hekte. So lebte Tolu im Kampf mit dem Gesez und der Gesellschaft, bis er am 22. September 1880 infolge mangelhafter Vorsicht seinerseits den Carabinieri in die Hände fiel. Wenn in anderen Teilen Italiens jemand eine Gewaltthat begangen hat, so pflegt er nach einer Beratung mit einem klugen Rechtsanwalt sich freiwillig der Behörde zu stellen, von der Zuversicht erfüllt, daß hundert mildernde Umstände für seine in blinder Leidenschaft begangene That in Betracht gezogen werden und wohl gar seine völlige Freisprechung bewirken können; den Sarden dagegen sieht man nach vollbrachter Blutthat stets entfliehen und die harte Strafe des Banditenlebens freiwillig auf sich nehmen, eine Strafe, die meist lebenslänglich ist, denn wenn sie nicht durch die Gefangennahme des Thäters abgekürzt wird, so macht ihr erst die Kugel der Carabinieri oder der natürliche Tod ein Ende. Aus dem Lebensbild Giovanni Tolus läßt sich dieser Unterschied teilweise erklären. Die Gründe wurzeln in dem infolge der insularen Abgeschlossenheit zäh bewahrten sardischen Volkstum; sie sind vor allem ein unüberwindliches Mißtrauen gegen die öffentliche Justiz und gegen alle staatlichen Einrichtungen überhaupt, dann der unbändige Freiheitsdrang, wie er wilden und halbzivilisierten Völkern eigen, deren Ideal das ungebundene Jägerleben in Wald und Bergen ist. Im Grunde geht beides auf eine mangelhafte soziale Erziehung zurück, derzufolge das Individuum sein Dasein nicht zunächst unter dem Gesichtspunkt der Zugehörigkeit zu einer bürgerlichen Gemeinschaft, sondern seines urwüchsigen Verhältnisses zur Natur betrachtet. Auf diesem Wege allein ist es zu begreifen, daß eine Kernnatur wie Giovanni Tolu, in dem eher das Zeug zu einem braven Landbürgermeister als zu einem Verbrecher steckte, ein lebenslängliches gefahrvolles Banditentum der Möglichkeit einer Freiheitsstrafe ohne weiteres vorzog. Am dritten Tage nach seinem Angriff auf den Pfarrer Pittui wußte er, daß sein Opfer außer Lebensgefahr war; dennoch entzog er sich der geseßlichen Buße und warf sich kopfüber in ein Leben hinein, von dem er selbst wußte und unverhohlen aussagte, daß seine wesentlichsten Aufgaben sind: sich den Verfolgungen der Polizei und ihrer Spione zu entziehen und sich von den Verfolgern und den hinter ihnen stehenden persönlichen Feinden zu befreien, d. h. sie durch Mord zu beseitigen.
Die seltsamen sozialen Verhältnisse Sardiniens brachten aber bald noch eine weitere Aufgabe für einen Banditen des besseren Schlags, wie Tolu einer war, hinzu, nämlich den Beruf eines irregulären, aber von den staatlichen Behörden und von der Gesellschaft anerkannten -Wächters der öffentlichen Sicherheit! Das klingt unglaublich und kann auch eigentlich nur von demjenigen völlig verstanden werden, der sich selbst in dieser sardischen Welt bewegt hat, die von der modernen Kultur Europas durch ein Jahrtausend getrennt er= scheint. Kehren wir zu Tolus Lebenslauf zurück. Er ließ am Morgen des 27. Dezember 1850 den übel zugerichteten Pfarrer unter der Fürsorge der Bauern von Florinas und sprengte auf seinem Gaul in die Welt hinaus. In einer Entfernung von 10 bis 15 Kilometer vom Dorf brachte er den ganzen Tag versteckt zu, ohne etwas zu genießen, und mit einer Wunde am Fuß, die er sich beim Ueberspringen einer Mauer zugezogen hatte. In der folgenden Nacht kehrte er heimlich zu Fuß ins Dorf zurück und verbarg sich im Hause einer verheirateten Schwester. Dort blieb er zehn Tage, um seine Wunde zu heilen, bei Tage in einem Kornschrank, bei Nacht auf einem improvisierten Bett, während die Carabinieri vergeblich in Florinas und Umgegend nach ihm suchten. Kaum genesen wanderte Tolu heimlich nach Sassari und fand in dem Hause eines ihm befreundeten angesehenen Bürgers Rat und Zuflucht. Seine erste Sorge war, einen Geistlichen auszukundschaften, der ihn von der Behexung durch Pittui endgültig befreien könnte, und sich von neuem mit Schußwaffen zu versehen. Einige Tage später begab sich Tolu, geleitet von seinem Zwillingsbruder, nach dem etwa 80 Kilometer ent= fernten Dorfe Dualchi bei Macomer, wo ein als Zauberbanner berühmter Pfarrer lebte. Dieser Gottesmann besaß auch ein ausgezeichnetes Rennpferd. Als Tolu ihm sein Anliegen vortrug und den Namen des Pfarrers Pittui nannte, der ihn verhext habe, entgegnete der Pfarrer von Dualchi ungesäumt: „Ah, den kenne ich, er hat auch einen trefflichen Gaul. Aber meiner ist besser, und ebenso bin ich ihm im Hexen über.
Ich will dir einen Zauber anhängen, gegen den jener ohnmächtig ist. “ Die Entzauberung ging in aller Form vor sich; Tolu ward sein Leiden los, gewann seine frühere Kraft und Gesundheit wieder und schenkte dem hochwürdigen Hexenmeister von Dualchi aus Dankbarkeit drei Taschentücher, ein Kilogramm Kaffee und acht Pfund Zucker. Durch Verwandte erfuhr nun Tolu alles, was im Hause Pittui vorging, und was gegen ihn geplant wurde. Nach seiner Erzählung gewann der von ihm mißhandelte Pfarrer im Laufe des Januar 1851 nicht weniger als acht gemeine Kerle, die bereit waren, seinem entflohenen Angreifer das Lebenslicht auszublasen. Mit Befriedigung berichtet Tolu, oft unter Angabe der kleinsten Nebenumstände, wie seine Verfolger einer nach dem andern umkamen, ohne daß sie ihr Mütchen an ihm kühlen konnten. Drei Wochen nach Tolus Flucht wurde einer, Namens Pietro Rassu, von einem Carabiniere erschossen, der ihn in der Dunkelheit für Tolu selber hielt! Als dieser die Kunde erhielt, rief er aus: „Das wäre einer! Gott hat mir einen Schuß Pulver sparen wollen. „Andere fanden ein ähnliches Ende, zwei oder drei hat Tolu eigenhändig ins Jenseits befördert. Einen von diesen, Francesco Rassu, den Tolu besonders haßte, verwundete er durch einen Schuß aus dem Hinterhalt, und als er erfuhr, daß der Verwundete in sein Haus nach Florinas gebracht worden, schlich Tolu nachts in das Dorf mit dem festen Vorsak, den Feind auf seinem Krankenlager umzubringen, konnte die Absicht aber nicht ausführen. Am 4. Januar 1853 endlich, nachdem Tolu dem wiederhergestellten Rassu tagelang vergeblich aufgelauert hatte, traf er ihn unweit Florinas im Morgengrauen. Nach einem fürchterlichen Kampf Körper an Körper tötete er ihn mit zahlreichen Dolchstichen. Die Leiche Rassus wurde so übel zugerichtet ausgefunden, daß die Gerichtsärzte erklärten, er sei von vier Mann überfallen worden. „Nun traue einer noch den gerichtlichen Gutachten,“ bemerkte Tolu trocken, als er den Vorfall seinem Biographen erzählte. Einen dritten Rassu erschoß Tolu im September 1854.
Ein vierter von derselben Familie, den er auch aufs Korn genommen hatte, war mit einer Tante Tolus verheiratet, und darum wollte er die Frau zuvor warnen, Er suchte sie heimlich auf und sagte ihr: „Liebe Tante, ich fürchte sehr, daß du bald Witwe wirst.“ „Was willst du damit sagen?“ war die Antwort, „mein Mann ist gesund und kräftig.“ „Aber ich werde ihn töten,“ fuhr Tolu fort, wenn er sich nicht gut aufführt; er hat böse Absichten gegen mich. “ Hierauf versicherte ihn die Tante, sie werde nicht dulden, daß ihr Mann ihm ein Haar krümme; solange sie lebe, werde Tolu sicher vor jenem sein. Die „energische und entschlossene“ Tante hielt Wort, und Tolu „begnadigte“ ihren Gatten, nachdem die übrigen Familienmitglieder „von der Gerechtigkeit Gottes gestraft waren, der die Verräter und Spione haßt“. Tolus brennendster Wunsch, den Pfarrer Pittui eigenhändig zu töten, ging nicht in Erfüllung; zu seinem großen Leidwesen und doch zugleich zu seiner Beruhigung mußte er eines Tages erfahren, daß Pittui während eines Aufenthalts in Sassari erkrankt und gestorben war. Es würde zu weit führen, alle die abenteuerlichen und bluttriefenden Zusammenstöße zwischen Tolu und seinen Verfolgern zu erzählen, aus denen er oft wie durch ein Wunder sein Leben und seine Freiheit rettete. Mit der Schlauheit, grausamen Kaltblütigkeit und Todesverachtung einer Rothaut begabt, schritt der Bandit über die Leichen von Dorfgenossen und Carabinieri hinweg zu neuen Thaten. In contumaciam zum Tode verurteilt, mit einem Kopfpreis von einigen hundert Thalern ausgezeichnet, lebte er den Behörden zum Trok dreißig Jahre lang als „König der Campagna“ in der Umgegend von Sassari, Porto Torres und Alghero, ohne je dieses engere Gebiet seiner sardischen Heimat zu verlassen.
Das Dasein eines sardischen Banditen ist eben nur, so paradox das klingen mag, in der nächsten Umgebung seines Heimatsorts möglich, wo ihn alle Welt kennt. Anderwärts sucht der verfolgte Uebelthäter Sicherheit in einer fernen, neuen Umgebung, wo er völlig fremd ist; in Sardinien sucht und findet er diese verhältnismäßige Sicherheit nur auf dem heimischen Boden, „wo er Verwandte zur Beratung findet und Rachethaten zu vollbringen hat“. Wovon lebte der Mann, nachdem er sich durch Flucht seinem friedlichen bäuerlichen Erwerb entzogen hatte? Vom Raub? Keineswegs. Tolu rühmt sich, und man darf ihm im allgemeinen glauben, daß er sich nie fremdes Gut durch Gewalt oder List angeeignet hat. Teils steckten ihm seine Verwandten und Freunde den Lebensunterhalt zu, teils fristete er sein Dasein mit Hilfe der weitgehenden sardischen Gastfreundschaft; auch die Jagd bot ihm einen Teil des Unterhalts, und mit der Zeit verschaffte er sich durch seinen Banditenberuf gewisse Einnahmequellen, ohne Erpressungen und Räubereien zu verüben, wovon später noch zu reden ist. Seine Mutter versorgte ihn jahrelang bei geheimen Zusammenkünften nicht nur mit frischer Wäsche, sondern auch mit Nahrung und Geld. Durch die Campagna streifend in Begleitung seiner Waffen, eines guten Pferdes und eines treuen Hundes, der den Namen „Pensa pro te“ führte, suchte er Schuß und Unterkunft in Felsschluchten, Wäldern und einsamen Schäferhütten oder Mühlen, meist am Tage schlafend und nachts wachend. Dreißig Jahre lang hat er zum Schlafen niemals Kleider und Schuhe abgelegt. Kehrte er bei Hirten, Müllern oder Grundbesikern ein, die ihn gern oder ungern gastlich aufnahmen, so gebrauchte er meist die Vorsicht, nicht in einem geschlossenen Raum zu essen. Um mit Behagen zu speisen, bedarf man einer gewissen Sicherheit, und die fand Tolu nur, wenn er sich im Freien niederließ, wo er die Umgebung überschauen konnte; daher ließ er sich gewöhnlich abseits von der Behausung unter freiem Himmel den Tisch decken. Oft wurden in dieser Weise große Schmausereien abgehalten, an denen nicht nur andere Banditen, die sich ihm angeschlossen hatten, sondern auch sehr anständige und angesehene Personen teilnahmen.
Die Vereinigung mit anderen Schicksalsgenossen bietet dem Banditen manchmal eine größere Sicherheit, aber sie bringt auch Gefahren mit sich. Tolu hat zwar nach einander ein Dukend anderer Banditen zu Gefährten gehabt, aber er hat selbst solche Bündnisse nie gesucht und sie währten auch nie lange, denn er mißtraute ihnen und oft mit Recht. Im Grunde seines Herzens war er besser als die meisten Leidensgenossen; seinem ritterlichen Sinn widerstrebten ihre Räubereien, Erpressungen und bezahlten Mordthaten, und oft genug trat er ihnen gegenüber nicht nur als Sittenprediger auf, sondern verhinderte auch gemeine Verbrechen, die jene geplant hatten, besonders wenn es sich um Schädigung seiner Landsleute von Florinas oder solcher Personen handelte, die ihm Gutes erwiesen hatten. Mit kaltem Blut und ohne Gewissensbisse konnte er aber seine Büchse gegen diejenigen richten, die er für seine Feinde hielt. Anfänglich war ihm das müßige Banditenleben sehr qualvoll; er klagte darüber, daß ihm, der an rüstige Feldarbeit gewöhnt war, die Tage und Nächte unendlich langsam verstrichen, und ein schmerzliches Gefühl erweckte ihm stets der Anblick fröhlicher Arbeiter auf dem Felde, während er der „große Müßiggänger unter so vielen fleißigen Menschen“ war. Da versiel der fast dreißigjährige Mann auf einen Zeitvertreib, der seinem besseren Teil alle Ehre macht. Er nahm die in der Kindheit vernachlässigten Studien wieder auf, verschaffte sich ein ABC- Buch und lernte mit unendlicher Mühe und Geduld in seiner Bergeinsamkeit das Lesen. Sein treuer Hund spiste verwundert die Ohren, wenn der Herr mit lauter Stimme die Säße der Fibel herausbuchstabierte. Als er die Anfangsgründe überwunden hatte, versah er sich mit einer Bibelausgabe und einer Geschichte der Könige von Frankreich, die seine Lieblingslektüre wurden und ihm reichen Stoff gaben, um an stillen Abenden am Herdfeuer die Insassen einer Mühle oder Schäferhütte mit abenteuerlichen Erzählungen zu erfreuen. Manche seiner flüchtigen Liebesabenteuer begannen damit, daß er wie Odysseus vor Nausikaa fremde und eigene Irrfahrten erzählte.
Nach wenigen Jahren seines Banditenlebens war Giovanni Tolu eine der populärsten Persönlichkeiten des nördlichen Sardiniens geworden, von vielen geliebt und verehrt, von anderen gehaßt und verfolgt, aber von allen gefürchtet. So begann er eine Rolle im sozialen Leben seiner Heimat zu spielen, und sein Dasein bekam einen neuen Inhalt, der ihm mannigfache Befriedigung gewährte. Während die strafende Gerechtigkeit und die Sicherheitsbehörde ihm auf den Fersen waren, übte er vermöge seiner Stellung eines „Königs der Campagna“ eine Gerechtigkeit und einen Sicherheitsdienst ganz besonderer Art. Ein Wort aus seinem Munde genügte, um ein Verbrechen zu verhüten, denn die Uebelthäter fürchteten seinen Arm mehr als den der Polizei und der Justiz. Von dieser Macht über die Gemüter machte er oft genug im guten Sinne Gebrauch. Manche private Streitigkeiten, die nach sardischem Brauch mit Mord und Totschlag zu endigen drohten, schlichtete er, indem er die Parteien um sich versammelte und ihre Aussöhnung erzwang. Dann empfand er eine „innere Befriedigung wie nach einer vollbrachten Rachethat“. Denjenigen, die durch Geschenke und Gastfreundschaft sein Wohlwollen erworben hatten, leistete er Dienste als Feld- und Viehhüter gegen die zahlreichen Diebe der Campagna, und manchen gestohlenen Ochsen hat er wieder in den Besiz des Herrn gebracht. Er bekleidete sogar zeitweise mit Einwilligung des Bürgermeisters und Gemeinderats von Florinas das Amt eines barracello und nahm am Ende des Jahres an der Gewinnverteilung des Barracellats teil. (Das Barracellat ist eine alte sardische Einrichtung, eine Art kommunaler Versicherungsgesellschaft gegen Viehraub.) In einem Jahre belief sich der Anteil des Banditen Tolu auf 70 Scudi (350 Lire), die ihm auch gewissenhaft vom Bürgermeister ausgezahlt wurden, während die staatliche Justiz vergeblich nach dem Geächteten suchte. Das Gute, dessen sich der Bandit und dukendfache Mörder Tolu rühmen kann, bestand nicht nur in Diensten, die er seinen Freunden und Dorfgenossen von Florinas leistete. Er hat gelegentlich auch der Gerechtigkeit unmittelbar unter die Arme gegriffen, statt ihr in den Arm zu fallen. Allerdings war er dabei wohl nie frei von selbstsüchtiger Berechnung, obschon er auch nie gegen Belohnung Spionen- oder Verräterdienste that; das wäre für einen braven Sarden ein unverzeihliches Verbrechen gewesen. Tolu verfuhr anders.
Mehr als einmal kam er in die Lage, von anderen Banditen, deren Missethaten er genau kannte, und mit denen er eine Weile zusammengelebt hatte, Verrat befürchten zu müssen. Er wartete dann geduldig ab, bis er die Beweise zu haben glaubte, daß sie ihm Fallen stellten und ihn den Carabinieri in die Hände zu liefern suchten, daß sie also seine Rache verdient hatten. Statt sie alsdann selbst zu töten, brachte er Zeugen und Beweise für ihre Verbrechen zusammen gleich dem geschicktesten Staatsanwalt und sekte schriftlich oder durch mündliche Aussagen anderer das Gericht davon in Kenntnis. Die Folge war dann, daß seine Feinde verhaftet, verurteilt und aufgehängt wurden, ohne daß sein Name dabei ins Spiel kam. So befreite er sich von seinen Widersachern, sparte sein Pulver und diente zugleich der Gerechtigkeit. Eine echte Banditenmoral! Denn zweifellos würde Tolu, wenn ein Gefährte ihn auf gleiche Weise dem Gericht in die Hände geliefert hätte, diese That nicht als ein Erwachen des Rechtssinns gelobt, sondern als schwarzen Verrat verdammt haben. Hat er doch in anderen Fällen selbst entrüstet diejenigen abgewiesen, die ihm die Auslieferung seiner Genossen angesonnen haben. Besonders bemerkenswert in dieser Hinsicht ist folgender Vorfall. Tolu hatte sich durch befreundete Beamte bewegen lassen, ein Gnadengesuch an den König zu richten. Als Antwort wurde ihm nach drei Monaten, angeblich im Auftrag der Regierung, mitgeteilt, dieselbe sei bereit, die Begnadigung zu befürworten, wenn Tolu drei andere Banditen, die mit ihm zeitweilig vereinigt waren, der Polizei in die Hände spiele. Diese Eröffnung wurde ihm vom Bürgermeister von Florinas gemacht, und als Tolu erwiderte, er werde niemals seinen Namen und den seines Geburtsorts mit einer solchen Infamie beflecken, bat der Bürgermeister um Entschuldigung, daß er seiner Amtspflicht gemäß ihm den Vorschlag der Regierung mitgeteilt habe, lobte die Ehrenhaftigkeit des Banditen, indem er ihn freundlich auf die Schulter klopfte, und schenkte ihm zum Abschied einen Scudo.
Verlangte man auch später von Tolu keinen Verrat seiner Gefährten mehr, so konnte es doch nicht ausbleiben, daß er, nachdem er eine Berühmtheit und Macht geworden, von den Dienern der Gerechtigkeit als Helfer und Ratgeber gesucht wurde. Mehr als einmal wurde der Bandit, auf dem vielfache ungesühnte Blutschuld lastete, von den Behörden unter Zusicherung freien Geleits nach Sassari berufen, um über irgend einen wichtigen Vorfall befragt zu werden. Das erste Mal traute allerdings Tolu dem Geleitbrief nicht und zeigte ihn einem befreundeten pensionierten Beamten, bevor er sich darauf verließ; später gewöhnte er sich daran, unter freiem Geleit zu den Behörden gerufen zu werden wie an etwas Selbstverständliches und kam sogar mit dem Major der Carabinieri auf einen gewissen freundschaftlichen Fuß. Die erste Begegnung der beiden verdient eingehender berichtet zu werden. Der Major gab ihm zwei seiner Visitkarten und ließ Tolu eigenhändig seinen Namen darauf schreiben; dann sagte er, indem er ihm die eine Karte überließ: „Wenn du mit mir zu sprechen wünschest, schicke mir diese Karte, und ich werde zu der von dir bestimmten Stelle kommen; umgekehrt werde ich das Gleiche thun, wenn ich deiner bedarf: du kannst auf mein Wort zählen. “ Tolu antwortete: „Diese Versicherung ist überflüssig; denn wenn Sie das geschlossene Einverständnis verlehen würden, so wäre es Ihr eigener Schade, denn kein Geächteter meines Schlages würde dann noch bereit sein, der Justiz Aufklärungen zu verschaffen. “ Nach einigem Besinnen fuhr der Major fort: „ Aber mißverstehen wir uns nicht. Abgesehen von dem gelegentlichen Austausch dieser Karten, wodurch jede gegen dich begonnene Unternehmung aufgehoben wird, bin ich dir gegenüber frei und werde dir die Carabinieri auf den Hals schicken, wo ich glaube, dich finden zu können.“ Hierauf entgegnete Tolu: „Sie sind Major der Carabinieri und thun Ihre Pflicht; ich thue die meine. Seit zwanzig Jahren bin ich Bandit und halte meine Freiheit wert; ich habe die Carabinieri nie zuerst angegriffen, aber wenn sie mich angreifen, weiß ich mich zu verteidigen; das wissen Sie wohl! „
– Das Schicksal fügte es aber, daß Tolu von da an keine Kugel mehr gegen die Carabinieri abzusenden brauchte. „Desto besser für mich – und auch für sie,“ fügt er in seiner Biographie hinzu. Die zweite Hälfte seines Banditentums verlief überhaupt viel ruhiger und friedlicher als die erste. Hierzu trugen besonders zwei Umstände bei, die Vereinigung Tolus mit seinem einzigen Kind und die Erwerbung einiger Mittel, die dazu dienten, dem Kind ein bäuerliches Eigentum zu verschaffen. Den Anfang zu Tolus kleinem Vermögen bildete ein Strandraub, wohl der einzige Eingriff in fremdes Eigentum, den er begangen. Während er sich in der Nurra, der Nordwestecke Sardiniens, herumtrieb, träumte ihm, daß er an einem bestimmten Punkt der Küste ein gestran= detes Schiff sehe, welches große Reichtümer barg. Am folgenden Tage meldete ihm ein Schäferknecht, an jenem Punkt sei eine große Barke auf den Strand geworfen worden. Ueber die rasche Erfüllung seines Traumes verwundert, eilte der Bandit mit den Hirten, bei denen er wohnte, zu der bezeichneten Stelle, wo sie ein fremdes Schiff ohne Bemannung fanden, dessen Ladung aus Pistazien und Wachs bestand. Tolu teilte das Strandgut ehrlich mit den anderen und verkaufte bald darauf seinen Anteil Wachs für 500 Lire an einen Pfarrer in Florinas. Dieses Sümmchen vermehrte sich bald durch andere gelegentliche Einnahmen und Geschenke, und Tolu begann seine Mittel im landwirtschaftlichen Betrieb anzulegen. Da seine Lage als Bandit ihm nicht gestattete, selbst wieder Feldarbeit zu treiben, so beteiligte er sich an der Wirtschaft seiner Brüder und Schwäger, indem er ihnen Korn zur Aussaat kaufte und bei der Ernte seinen Gewinnanteil bezog. Bald war er im stande, eigene Schaf und Rinderherden unter der Obhut seiner Verwandten weiden zu lassen, und mit Befriedigung sah er das Erbteil sich mehren, welches die Zukunft seines Kindes sichern sollte. Die Geburt dieses einzigen Töchterchens Maria Antonia war einige Wochen nach Tolus Flucht aus Florinas, am 5. März 1851, erfolgt. Jahrelang hatte er es nicht gesehen, bis es ihm siebenjährig durch eine Verwandte auf einem Dreschplak im Felde zugeführt wurde.
Der Anblick des unschuldigen Geschöpfs übte eine gewaltige Wirkung auf den rauhen Banditen, viel mächtiger, als er es selbst in seiner Lebensgeschichte auszusprechen vermag. Das Kind hat ihn zu einem anderen Menschen gemacht; jest hatte er einen Lebenszweck, das Glück seines Töchterchens. Durch Vermittelung seiner alten Mutter entzog er Maria Antonia der Obhut seiner noch in Florinas lebenden Frau und ließ sie in Porto Torres unterbringen. Er selber verlegte, um dem Kinde nahe zu sein, den Schauplak seines Nomadenlebens in die Nurra, wo er aus seiner Jugendzeit, als er sich für Feldarbeit verdingt hatte, zahlreiche Freunde besaß. So konnte er sein Kind öfter sehen, es mit Zärtlichkeiten und Geschenken überhäufen und ihm die Anfangsgründe des Lesens beibringen. Dann ließ er die Tochter in Porto Torres die Schule besuchen und verlangte von ihr regelmäßige Briefe, aus denen der fast vierzigjäh = rige Vater-schreiben lernte. Entschlossen sagte er sich von der wilden Leidenschaft seiner ersten Banditenjahre los und dankte es als alter Mann noch seiner Tochter, daß sie ihn unbewußt von weiterem Blutvergießen abhielt und auf den Weg friedlicher und nüzlicher Thätigkeit zurückbrachte. Als Maria Antonia siebzehn Jahre alt geworden war, verlobte der Vater sie mit einem Vetter Agostino, des sardischen Grundsakes eingedenk, daß man Eheschließungen und Viehkauf am besten im Verwandtenkreise vornehme. Er pachtete für das junge Paar das Bauerngut Leccari unweit Porto Torres; für ihn selbst bot das Gut den Vorteil, daß nahe der Behausung sich ein mehrere Hektar umfassendes Röhricht ausdehnte, in welchem er sich vor den Carabinieri verbergen konnte. Am 1. Januar 1870 wurde in Porto Torres die Hochzeit gefeiert: der Brautvater konnte ihr zu seinem großen Leidwesen nicht beiwohnen, um nicht der Polizei in die Hände zu fallen. Aber er lebte in den folgenden zehn Jahren viel mit dem Ehepaar zusammen und hatte die Genugthuung, daß die Wirtschaft in Leccari unter seinem Beistand gut voranging.
Tolu war der erste, der in der Nurra mit einer Dampfmaschine dreschen ließ, und als er zur Erweiterung des Betriebs einmal 2000 Lire nötig hatte, erhielt er von einer Bank in Sassari ohne Schwierigkeit das verlangte Darlehen. Aber die Carabinieri ließen ihm keine Ruhe, sie kamen oft nach Leccari und suchten nach ihm. Seine Tochter zürnte ihnen mächtig darob und verweigerte ihnen darum die einfachsten Leistungen sardischer Gastfreundschaft. „Wie kann ich euch Speise und Trank gewähren, da ich weiß, daß ihr meinem Vater nachstellt!“ war ihre hartnäckige Antwort. Am 22. September 1880 ereilte den alten Tolu in Leccari das Geschick, dem er dreißig Jahre lang zu entgehen verstanden hatte; er wurde ohne Widerstand von den Carabinieri verhaftet, bevor er in das Rohrdickicht fliehen konnte, und am Abend desselben Tages im Gefängnis zu Sassari entkleidete er sich zum erstenmal seit drei Jahrzehnten, um schlafen zu gehen. Der Prozeß, der gegen ihn eingeleitet wurde, betraf nur die Tötung dreier Carabinieri in den Jahren 1853 und 1859, da andere seiner Verbrechen verjährt waren oder aus anderen Gründen nicht verfolgt werden konnten, und da seine einſtige Verurteilung in contumaciam zum Tode wegen eines Formfehlers aufgehoben worden war. Die Schwurgerichtsverhandlung wurde endlich von Sardinien weg nach dem römischen Städtchen Frosinone verlegt, da die Gerichtsbehörde nicht glaubte, auf der Insel unbefangene Geschworene für die Beurteilung des berühmten Banditen finden zu können. Die dreitägige Verhandlung von Frosinone brachte eine lange Reihe von Zeugenaussagen, die über den Banditen des Lobes voll waren, die einen nannten ihn den sardischen Friedensrichter, andere den Wohlthäter der Nurra, und einer verstieg sich gar zu der überschwenglichen Bezeichnung Dio della campagna. Das Ergebnis war, daß am Abend des 21. Oktober 1882 der mehrfache Mörder unter dem Jubel der Zuhörer freigesprochen wurde, weil er die drei Carabinieri im Zustand der Notwehr erschossen habe! Als Tolu den Gerichtssaal verlassen hatte, kniete er auf den Stufen der nächsten Kirche nieder, um Gott zu danken, und mit ihm knieten betend einige hundert Menschen, die von dem romantischen Zauber seiner Persönlichkeit bestrickt waren.
Von Frosinone ging er mit seinen Verwandten auf einige Tage nach Rom, um die neue Hauptstadt seines Vaterlandes kennen zu lernen; aber sie gefiel ihm gar nicht. Sein Urteil war: „Zu viele Menschen und zu viel Lärm. Die Denkmäler Roms entzückten mich nicht, denn sie sind Menschenwerk; auch in Sardinien könnte man dergleichen machen, wenn man Millionen ausgeben wollte. Ich empfinde Begeisterung nur für die Wunder der Natur, weil man sie auch mit Geld nicht nachmachen kann. “Nach seiner Heimatinsel zurückgekehrt, fand er einen jubelnden Empfang und erhielt als dote (Mitgist), die der Sarde freigesprochenen Angeklagten zu geben pflegt, von Freunden und Bekannten ein kleines Vermögen an Vieh geschenkt. Seinen Lebensabend verbrachte Tolu behaglich im Kreise der Seinen, und am 4. Juli 1896 starb er in Porto Torres, noch ehe seine Selbstbiographie im Druck erschienen war. Giovanni Tolu kann nicht, wie schon eingangs gesagt worden, als Typus des Verbrechertums gelten, wie es noch in unseren Tagen die Insel unsicher macht; seine eigene Lebensgeschichte beweist dies. Er gehört einer Gattung von Verbrechern an, die auch in Sardinien am Aussterben zu sein scheint. Aber er darf als der Typus des stolzen trokigen Volkstums der vergessenen Insel angesprochen werden, dem eigentlich nichts fehlt, um ein menschenwürdiges und fruchtbares Dasein zu führen, als eine weise Erziehung durch die im modernen Staat organisierte Gesellschaft. Was dort vor allem zu thun bleibt, sagt der Herausgeber der merkwürdigen Banditenbiographie, das ist Sache des Schulmeisters.
© Alle Rechte vorbehalten